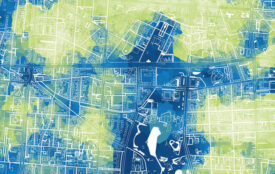Solares Laden: E-Autos kommen am besten viel in die Sonne
Damit E‑Autos ihren Klimavorteil voll ausspielen können, sollten sie mit möglichst viel Solarstrom vom eigenen Dach geladen werden. Wie das auch mit einer kleineren Photovoltaik-Anlage gelingt, untersuchten Forscher der HTW Berlin.
Beim Strom für Elektroautos geht es meist nur um die Kosten. Als am teuersten gilt das Laden an öffentlichen Säulen. 2024 waren dort für die Kilowattstunde 54 bis 64 Cent zu berappen, besagt eine Anbieterstatistik.
An E‑Autobesitzer ergeht so der Rat, sich eine eigene Wallbox zuzulegen und aus dem Netz Haushaltsstrom für etwa 35 Cent ins Fahrzeug umzuleiten. Die Wallbox kostet ordentlich, sie mache sich aber schnell bezahlt, versichern Ratgeber-Portale wie Finanztip.
Nur zehn Cent soll Strom fürs E‑Auto von der eigenen Solaranlage kosten, liest man dort weiter. So eine Kombination aus Photovoltaik vom Dach, Wallbox und vielleicht noch einem Speicher geht allerdings ins Geld und rentiert sich erst nach einigen Jahren.
Wer mit seinem „Treibstoff“ fürs E‑Auto auch etwas fürs Klima tun will, kommt an einer eigenen Solaranlage kaum vorbei. Zwar kann an öffentlichen Ladepunkten oder per Hausstromvertrag Grünstrom „getankt“ und so über die Zeit die Position der Erneuerbaren gestärkt werden, dies verbessert aber zunächst nicht spürbar den sogenannten CO2–Emissionsfaktor des deutschen Strommixes.
E‑Auto-Strom kommt zur Hälfte aus eigener Erzeugung
Dieser wird in erster Linie davon bestimmt, wie viel Strom in den Kraftwerken real fossil und erneuerbar erzeugt wird. Wer „sauberen“ Ökostrom aus dem Netz bezieht, erhöht automatisch den Emissionsfaktor für andere Nutzer, die dann „schmutzigeren“ Strom beziehen.
Insofern ist die Frage von Interesse, wie das Laden der E‑Autos mit selbst erzeugtem Photovoltaik-Strom derzeit so läuft und sich klimapolitisch optimieren lässt. Das haben jetzt Solarexperten der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin getan. Sie konnten dazu das Ladeverhalten von mehr als 700 Haushalten mit Solaranlage und E‑Fahrzeug analysieren. Die Daten hierzu kamen anonymisiert vom österreichischen Hersteller Fronius.
Die Ergebnisse überraschen durchaus. So deckt die eigene Solaranlage im Schnitt 47 Prozent des Strombedarfs von Haushalt und E‑Autos. Haben die Haushalte noch einen Batteriespeicher, steigt der Deckungsgrad auf durchschnittlich 73 Prozent.
Kommt noch eine Wärmepumpe hinzu, wird es laut der HTW-Analyse im Winter aber knapp. Dann reiche der eigene Solarstrom in der Regel nicht mehr aus, um den Stromverbrauch von Haushalt, E‑Auto und E‑Heizung zu decken. Haushalte, die ihre Energieversorgung vollständig auf Strom umstellen, können dann, übers ganze Jahr gesehen, im Mittel noch 59 Prozent seines Strombedarfs direkt aus der Solaranlage oder dem selbst gespeisten Heimspeicher decken, besagt die HTW-Studie.
Eigene solare Größe zählt dabei nicht nur im Winter, sondern auch beim E‑Auto-Laden. So können bei einer Fahrleistung von jährlich 10.000 bis 15.000 Kilometern Haushalte mit einer solaren Nennleistung von fünf bis zehn Kilowatt im Schnitt 46 Prozent des Energiebedarfs ihres Pkw selbst decken.
Hat die Solaranlage hingegen eine installierte Leistung von 15 bis 20 Kilowatt, erhöht sich laut Studie der solare Anteil am Ladestrom auf 62 Prozent. Große Photovoltaikanlagen wirken sich daher positiv auf den ökologischen Fußabdruck des Elektrofahrzeugs aus, betonen die HTW-Fachleute. Derzeit verfügt die private Solaranlage hierzulande laut Branchenverband BSW Solar im Schnitt über 13 Kilowatt.
Ein Haus mit viel Dachfläche, einem überdachten Carport oder einem zusätzlichen Steckersolargerät im Garten ist da gern gesehen. Dazu kommt jetzt meist noch ein Heimspeicher.
Luft nach oben
Wie sich der ganze Aufwand auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Flächen- und Ressourcenverbrauch auswirkt, sei hier dahingestellt. Das Problem ist offenbar den HTW-Experten nicht fremd. So plädieren sie für eine Ladevariante, mit der auch bei kleiner Solaranlage viel eigener Strom ins Auto zu bekommen ist – mit dem dynamischen Überschussladen.
Dabei wird die Ladeleistung der Wallbox automatisch an den solaren Überschuss angepasst, der im Haushalt gerade verfügbar ist. Im Vergleich zum herkömmlichen Vorgehen – das E‑Fahrzeug wird mit maximaler Leistung geladen – lässt sich beim Überschussladen der Solaranteil im Schnitt um 25 Prozentpunkte bei sonst gleichen Rahmenbedingungen steigern, beziffert Nico Orth von der HTW Berlin den Klimaeffekt.
Derzeit sollen schon 99 Prozent der Nutzer ihr E‑Auto auch solar laden, aber nur zwei Drittel von ihnen machen das hauptsächlich tagsüber und erreichen somit höhere Solaranteile. Viele dieser Tagsüber-Haushalte laden ihr Auto dabei laut den Angaben etwa dreimal wöchentlich, und das jedes Mal mit einer eher geringen Strommenge von durchschnittlich 8,6 Kilowattstunden. Damit kommt so ein E‑Auto um die 50 Kilometer weit.
Auf diese Weise versuchen die Haushalte nach Einschätzung von Nico Orth, den Kostenvorteil des eigenen Solarstroms – so weit es geht – zu nutzen.
Neben dem Lade-Peak tagsüber zeichnet sich in den HTW-Daten ein zweiter Peak für die Nacht ab. Hinter den beiden Spitzenzeiten stehen vermutlich unterschiedliche Nutzungsroutinen für das E‑Auto. So ergab eine Verknüpfung der Ladezeiten mit sozialen Umständen, dass vollzeitbeschäftigte E‑Auto-Nutzer eher nur unterdurchschnittliche Solaranteile beim Laden von etwa 40 Prozent erreichen, während Teilzeitler, Ruheständler und Home-Office-Tätige eher auf 60 Prozent und mehr kommen.
E‑Autos sind für schnelles Laden ausgelegt
Auf das von den Forschern empfohlene langsame Überschussladen sind E‑Autos übrigens wenig eingestellt. „Heutige Elektrofahrzeuge sind für schnelles Laden mit hoher Leistung ausgelegt“, erläutert Joseph Bergner, Koautor der Studie. Das widerspreche dem solaren Laden, bei dem längere Ladezeiten mit geringen Leistungen im Fokus stehen, ergänzt Bergner.
Eine Folge dieser Konfiguration der E‑Autos: Bei der minimal notwendigen Ladeleistung von 1,4 Kilowatt kommen laut der Studie im Schnitt nur 76 Prozent der Solarenergie in der Batterie an. Bei elf Kilowatt Ladeleistung sind es dagegen 90 Prozent.
Ein Grund für die Verluste beim Laden ist auch der hohe Eigenverbrauch der E‑Fahrzeuge. Ihre Bordelektronik benötigt allein beim Laden 150 bis 350 Watt für sich selbst, so die Studie. „Dass E‑Autos einen so hohen Eigenbedarf haben, hat mich selbst überrascht“, räumt Nico Orth ein.
Insgesamt liegen die Wirkungsgrade der Fahrzeugladegeräte, wie die HTW-Studie kritisiert, deutlich hinter denen ähnlich starker Wechselrichter von Heimspeichern zurück. Letztere verfügten bei zehn Kilowatt Leistung über Wirkungsgrade von 95 bis 98 Prozent.
Die Forscher bemängeln auch die niedrige Effizienz einiger Wallboxen. Nach den Angaben beziehen Haus-Ladegeräte im Stand-by-Modus zusätzlich bis zu 20 Watt Leistung.
Allein das summiere sich auf jährlich bis zu 164 Kilowattstunden Mehrverbrauch, rechnet die Studie vor. Um diese Strommenge zu erzeugen, muss eine Dachanlage die Sonne schon ein paar Tage lang sehen.
Fazit: E‑Autos sind fürs Klima besser als fossile, können aber samt ihrem Lade-Equipment ziemliche Stromfresser sein, selbst wenn sie nur rumstehen.
Wer sein E‑Auto selbst langfristig preiswert und mit gutem Klimaeffekt „tanken“ will, sollte entweder ein kleines Auto oder eine große Solaranlage haben, möglichst tagsüber mit Überschussstrom und einer Wallbox laden – und das Fahrzeug auch öfter mal stehen lassen und anders CO2-arm oder CO2-frei mobil sein.
Quelle
Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Jörg Staude) 2025 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden!