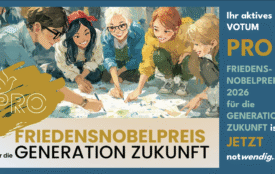Dekarbonisierung der Industrie: Zementindustrie sucht den Weg aus der CO₂-Falle
Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim baut in Schleswig-Holstein ein „klimaneutrales“ Zementwerk mit CO2-Abscheidung. Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen mit einer gerichtlichen Klage wegen seiner historischen Klimaemissionen konfrontiert.
Zement ist der Baustoff der Moderne. Ohne ihn gäbe es keine Straßen, Brücken, Hochhäuser oder Windräder.
Doch seine Klimabilanz ist miserabel: Rund acht Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen stammen allein aus der Zementproduktion – mehr, als der gesamte internationale Flugverkehr verursacht. Soll die Welt ihre Klimaziele erreichen, muss die Branche radikal umgebaut werden.
Ein wichtiger Schritt dazu passiert in Schleswig-Holstein. Die deutsche Tochter des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim will dort im Werk Lägerdorf bei Brunsbüttel bis zum Ende des Jahrzehnts eines der ersten „klimaneutralen“ Zementwerke der Welt errichten.
Das Projekt nennt sich „Carbon2Business“ und wurde von der EU als erstes deutsches „strategisches Vorhaben“ im Rahmen des Net Zero Industry Act ausgezeichnet.
Mit diesem Gesetz will Brüssel die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie sichern und zugleich die CO2-Einsparung beschleunigen – ursprünglich als industriepolitischer Gegenentwurf zum milliardenschweren Inflation Reduction Act der USA entwickelt, der 2022 unter Präsident Joe Biden aufgelegt worden war.
Gemeinsam mit Partnern wie Linde und dem Erdgas-Netzbetreiber OGE baut Holcim in Schleswig-Holstein eine Anlage, die jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen CO2 abscheiden soll, das in der Zementproduktion entsteht. Das Gas wird dabei hochrein aufbereitet.
Das Kohlendioxid wird vorerst per CCS entsorgt
Ziel ist es laut Holcim, das CO2 zu nutzen, etwa in der chemischen Industrie, wo es fossile Grundstoffe ersetzen kann. Zunächst soll es aber unterirdisch gespeichert werden, etwa in Offshore-Lagerstätten unter der Nordsee.
Dazu soll eine etwa 30 Kilometer lange Pipeline vom Zementwerk zum Elbhafen Brunsbüttel entstehen. Von dort aus kann das CO2 verschifft oder in die Pipelines anderer Industriewerke eingespeist werden.
Die Investitionen belaufen sich dem Konzern zufolge auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag, die EU unterstützt das Projekt mit 110 Millionen Euro. Holcim ist seit der Fusion mit dem französischen Unternehmen Lafarge vor zehn Jahren zu einem der weltweit größten Zementhersteller aufgestiegen und heute in 45 Ländern tätig.
Die Europäische Kommission würdigte das Vorhaben als „strategisch“ für die Industriepolitik. Kerstin Jorna, EU-Generaldirektorin für Binnenmarkt und Industrie, nannte Lägerdorf „ein Vorzeigeprojekt dafür, wie Dekarbonisierung die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und Europas Netto-Null-Ziel für die Treibhausgase in einen globalen Wettbewerbsvorteil verwandelt“.
Auch die Politik in Deutschland sieht darin ein Signal. Frank Wetzel, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sprach von einem „zentralen Schlüssel, um unseren Industriestandort zukunftsfähig zu halten“.
Schleswig-Holsteins Energiestaatssekretär Joschka Knuth (Grüne) bezeichnete das Werk als „besonders strategisches Vorzeigeprojekt“ – und verband das mit einer Forderung: Die Bundesregierung müsse jetzt die politischen Rahmenbedingungen setzen, damit weitere Industrieunternehmen nachziehen könnten.
Fachleute fordern ein generelles Umdenken im Bausektor
Dass solche Großprojekte notwendig sind, liegt am Kernproblem des Zements. Sein Hauptbestandteil Klinker entsteht, wenn Kalkstein im Drehrohrofen bei 1.450 Grad gebrannt wird. Dabei spaltet sich CO2 ab, was für zwei Drittel der Gesamtemissionen verantwortlich ist. Das restliche Drittel stammt aus den fossilen Brennstoffen, die die hohen Temperaturen liefern. Insgesamt verursacht eine Tonne Zementklinker im Schnitt fast eine Tonne CO2.
Die Industrie ist unter Druck, klimaneutral zu werden. Holcim versucht den CO2-Ausstoß durch drei Strategien zu senken: weniger Klinker im Produkt, Recycling von Altbeton und, wie in Lägerdorf, Abscheidung von CO2. Nach eigenen Angaben vertreibt der Konzern bereits etwa 20 Sorten CO2-reduzierter und recycelter Zemente, die bis zu 40 Prozent weniger Emissionen verursachen. Die Baustoffe sollen „kreislauffähig“ werden.
Doch auch die Konkurrenz ist aktiv. Der Konzern Heidelberg Materials baut in Norwegen das weltweit erste Zementwerk mit vollständiger CO2-Abscheidung, aus dem jährlich rund 400.000 Tonnen des Treibhausgases in ein Lager unter der Nordsee verpresst werden sollen.
Das mexikanische Unternehmen Cemex setzt auf mehr Biomasse als Brennstoff, entwickelt aber auch alternative Zementrezepturen. Und in China, wo mehr als die Hälfte des weltweiten Zements produziert wird, arbeitet die Regierung an neuen Standards für CO2-ärmere Baustoffe – wohl entscheidend für den globalen Trend.
Die Techniken der CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) respektive -Nutzung (CCU) gelten als Schlüssel, um nicht vermeidbare Restemissionen aus der Atmosphäre fernzuhalten. Sie sind allerdings teuer und energieintensiv. Kritiker warnen, dass CCS den Übergang zu wirklich klimafreundlichen Baustoffen verzögern könnte.
Viele Fachleute plädieren deshalb für ein grundsätzliches Umdenken im Bausektor: Gebäude müssten materialeffizienter geplant, länger genutzt und häufiger saniert statt abgerissen und neu errichtet werden. Zudem rücken alternative Baustoffe wie Holz in den Fokus.
Quelle
Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Joachim Wille) 2025 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden!