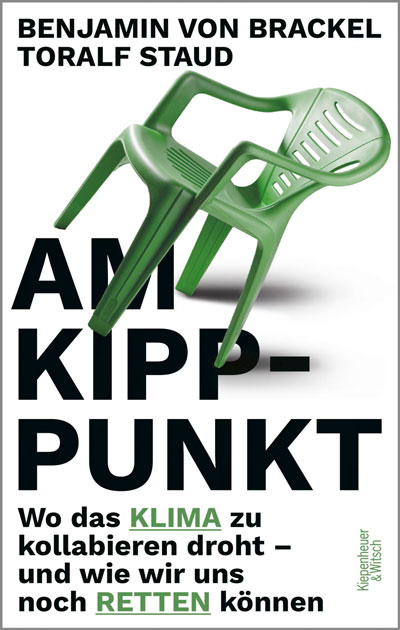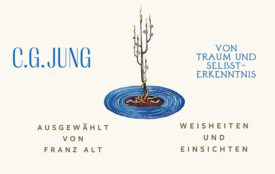Der Kipp-Krimi
Wer wissen will, was für den Planeten und die Menschheit ab 1,5 Grad Erwärmung auf dem Spiel steht, kann es nun detailliert nachlesen. Die Autoren vermeiden Panikmache und lassen Fakten sprechen. Dramatisch wird es trotzdem.
Der Klimawandel ist längst im Alltag vieler Menschen angekommen: Extreme Waldbrände wie aktuell in Spanien und Portugal, Hitzesommer mit Temperaturrekorden wie im Jahr 2022, rasant schmelzende Gletscher in den Alpen, im Himalaya, in den Anden. Doch die Gefahren, die die Menschheit seit 200 Jahren mit ihrer fossilen Kohle-, Öl- und Gaspyromanie heraufbeschwört, gehen weit darüber hinaus.
Es drohen unumkehrbare Veränderungen und die Vernichtung ganzer ökologischer Großsysteme. Die Erde könnte in einen neuen „Betriebszustand“ fallen, der sie teilweise unbewohnbar macht. Das ist das Thema des neuen Buches „Am Kipppunkt“ der langjährigen Klimajournalisten Benjamin von Brackel und Toralf Staud, die beide dieses Magazin mitgegründet haben.
Der Titel macht die Dringlichkeit klar. Klima-Kipppunkte sind jene Schwellen, ab denen gefährliche Prozesse im globalen Klimasystem nicht mehr aufzuhalten sind und sich selbst verstärken – darunter das Abschmelzen der Eisschilde von Grönland und Antarktis, das Austrocknen des Amazonas-Regenwaldes, die Vernichtung der Korallenbänke in den Tropen, das Auftauen der Permafrostböden.
Brackel und Staud erklären diese Mechanismen präzise und anschaulich. Wer bislang nur vage von „Kipppunkten“ gehört hat, erhält hier eine gut lesbare Einführung.
Doch auch für Leserinnen und Leser, die der Klimadebatte seit Jahren folgen, ist die Lektüre spannend. Denn noch nirgends sonst hat man die wissenschaftliche Detektivgeschichte, welche die Aufdeckung dieser Kippelemente war und ist, so detailliert gelesen. Es ist eines der wichtigsten Klima-Bücher der letzten Jahre.
Kipppunkte erst ab vier Grad Erwärmung
Stilistisch setzen die Autoren auf eine Mischung aus wissenschaftlicher Erklärung und reportagehaften Szenen. Sie sprechen mit Forscherinnen und Forschern, begleiten Betroffene, machen abstrakte Aussagen plastisch.
So illustrieren sie beispielsweise, wie sich das Auftauen der Permafrostböden in den Alpen schon heute auswirkt. Sie beschreiben, wie ein US-Forscher 2021 erlebt, dass zum ersten Mal seit Menschengedenken auf dem Gipfel des Grönländischen Eisschildes Regen fällt.
Sie zeichnen detailliert nach, wie Fachleute bereits seit Jahrzehnten an der Frage knobeln, wie wahrscheinlich das Abreißen der Atlantischen Umwälzzirkulation AMOC inklusive des Golfstroms ist, die Europa das warme Klima beschert. Diese Passagen sind eindrucksvoll, das journalistische Erzählen erzeugt Nähe.
Die Autoren zeichnen ausführlich die rasante Entwicklung der Kipppunkt-Debatte nach, die maßgeblich zur Ausgestaltung des Pariser Klimavertrags von 2015 beigetragen hat. Die Festlegung des Ziels einer maximalen Erderwärmung von zwei, besser aber nur 1,5 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit beruht unter anderem darauf, dass das Auslösen der Kippelemente verhindert werden soll.
Hinweise aus der Klimageschichte, dass Kippelemente im Klimasystem existieren könnten, gab es zwar schon seit den 1980er Jahren. Doch noch 2001 im dritten Sachstandsreport des Weltklimarats IPCC, der Bibel der Klimaforschung, wurden die „großskaligen Diskontinutäten“, wie man die Kipppunkte damals noch nannte, zwar als einer von mehreren „Gründen zur Besorgnis“ aufgeführt, aber bis zu einer Erwärmung von vier Grad als irrelevant betrachtet. Heute weiß man: Bereits ab 1,5 Grad wird es kritisch.
Wird das Risiko maßlos übertrieben?
Gebührend kommt in dem Buch daher auch Hans Joachim Schellnhuber zu Wort, der das Wort „Kipppunkte“ in die wissenschaftliche und politische Debatte eingeführt hat. Der erste Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung entwickelte um das Jahr 2000 ein frühes Konzept zu jenen neuralgischen Punkten im Klimasystem, die er damals noch „Umschlagpunkte“ nannte.
Doch erst als er unter Rückgriff auf eine Formulierung des US-Reporters Malcom Gladwell das Ganze tipping points (Kipppunkte) nannte, bekam das Konzept die große Aufmerksamkeit, die es heute hat.
Von Brackel und Staud gehen natürlich auch auf die wissenschaftliche Kontroverse ein, die sich nach der beispiellosen Karriere des Kipp-Konzepts entwickelt hat. Denn, so die Autoren: „Nicht allen in der Forschungsszene gefiel das, und das sollte insbesondere Schellnhuber zu spüren bekommen.“
Einer der bekanntesten Kritiker wird zitiert, der Direktor des renommierten Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, Jochem Marotzke, der Sätze sagt wie: „Das Risiko durch Kipppunkte wird oft maßlos übertrieben.“ Marotzke betont, die Worst-Case-Szenarien seien „völlig ausgeschlossen“, spricht halb scherzhaft sogar von der „Kipppunkte-Mafia“ um Schellnhuber und seinen Co-Forscher auf dem Feld, den Briten Tim Lenton.
Und er warnt, das damit einhergehende „Katastrophen-Narrativ“ sei nicht nur falsch, sondern sogar kontraproduktiv. Der starke Fokus auf die Kippelemente lenke die Aufmerksamkeit von anderen Gefahren ab, über die in der Forschung viel mehr Gewissheit bestehe – etwa die Zunahme von Starkniederschlägen wie bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021.
Marotzke gibt nach der Meinung der Buchautoren aber zu viel Entwarnung. Das Risiko sei groß, dass „vor allem ein Eindruck hängen bleibt: Ganz so schlimm wie gedacht wird es zum Glück doch nicht kommen“.
„Ausradiert wird die Menschheit nicht“
Dass es bei einem fortgesetzten Aufwärtstrend der globalen Emissionen und mangelhaftem Klimaschutz tatsächlich ganz schön schlimm kommen wird, daran lassen von Brackel und Staud keinen Zweifel. Sie verweisen auf mittlerweile Tausende wissenschaftliche Publikationen zu den Fragen der Kipppunkte. Manche Kippelemente seien in der Debatte weggefallen, dafür andere hinzugekommen. Unter dem Strich aber habe das wissenschaftliche Konzept Bestand.
Die Stärke des Buches liegt in der Klarheit der Darstellung. Die Autoren vermeiden Panikmache, sie lassen Fakten sprechen. Gleichzeitig formulieren sie ein eindeutiges Plädoyer: Noch bleibt Zeit, Katastrophen abzuwenden – vor allem, indem „positive Kipppunkte beim Klimaschutz“ ausgelöst werden.
Diesen widmen sie drei Kapitel: zum „Solarwunder“ durch erneuerbare Energien, zur „E-Auto-Revolution“ und zur „Fleischwende“ in der Ernährung. Deutlich wird, dass auch hier Entwicklungen viel schneller als erwartet verlaufen und negative Trends in wenigen Jahren ins Positive kippen können.
Die Autoren betätigen sich damit freilich ein wenig wie die Rufer in der Wüste, denn in ihrem Buch ist doch klar geworden: Das Fenster für Veränderungen schließt sich rasant, und in einer Welt, die mit dem Trumpismus gestraft ist, noch schneller.
Am Ende lassen von Brackel und Staud einen gewissen Pessimismus durchblicken. Sie glauben, dass bestimmte Kipppunkte wie etwa das Absterben der Korallenriffe und der Beginn des Abschmelzens der Eisschilde an Nord- und Südpol kaum noch zu verhindern sind.
„Werden erste Kipppunkte überschritten, dann bedeutet das zweifellos viel Leid und Wirren, und, ja, viele Menschen werden sterben. Aber komplett ausradiert wird die Menschheit nicht.“ Will sagen: Die Welt wird dann zwar nicht untergehen, aber es wird eine andere Welt sein – auf die wir nicht eingestellt sind.
- Benjamin von Brackel, Toralf Staud: Am Kipppunkt. Wo das Klima zu kollabieren droht und wie wir uns noch retten können. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025. 384 Seiten, 20 Euro
- Sonnenseite „Am Kipppunkt: Wo das Klima zu kollabieren droht – und wie wir uns noch retten können“ | Hans-Josef Fell 2025
Quelle
Die Rezension wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Joachim Wille) 2025 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden!