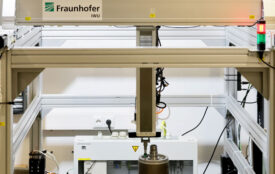Wie nachhaltige Klimapolitik und solide Staatsfinanzen miteinander vereinbar sind
Maßnahmen zum Kampf gegen die Erderhitzung rechtfertigen zusätzliche Staatsschulden – und zwar in dem Umfang, wie sie CO₂-Emissionen und in der Folge Klimaschäden verhindern. Das ist der Kerngedanke einer „grün-goldenen Regel für die Klimapolitik“, die jetzt in Perspektiven der Wirtschaftspolitik vorgestellt wurde.
Die Studie wurde geleitet vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Für Deutschland erscheinen demnach, sofern die gesetzten Ziele strikt eingehalten werden, für Klimaschutz bis 2030 insgesamt 161 Milliarden Euro neue Schulden vertretbar und ökonomisch sinnvoll.
Die Veröffentlichung im Journal des hoch angesehenen, bereits 1873 gegründeten „Vereins für Socialpolitik“ ist zuallererst konzeptionell – aber sie berührt ein politisch heiß diskutiertes Thema: Wie kann der Staat, im Interesse künftiger Generationen, einerseits eine inneffizient hohe Verschuldung vermeiden und andererseits genug in langlebige öffentliche Güter investieren? „Unser Konzept macht nachhaltige, zukunftsfeste Politik vereinbar mit soliden Staatsfinanzen“, sagt PIK-Direktor Ottmar Edenhofer, einer der Autoren. „Es minimiert das Risiko missbräuchlicher Mittelverwendung im Namen hehrer Ziele. Und es ist hier für die Klimapolitik durchdekliniert, aber auf andere Politikfelder übertragbar.“
Ausgangspunkt ist die wissenschaftlich schon ausführlich beleuchtete Kurzfristorientierung von Regierungen. Deshalb, so führt das Forschungsteam aus, macht die Politik übermäßig Schulden, trotz der späteren Belastung durch Zins und Tilgung. Und aus diesem Grund steckt sie im Falle eines prinzipiellen Schulden-Verbots, wie es zuletzt lange Jahre in Deutschland galt, übermäßig viel Geld in laufende Ausgaben statt in Investitionen – bei denen ja nur ein Bruchteil des Nutzens in der kurzen Frist anfällt.
Die Lockerung der Schuldenbremse lässt sich rechtfertigen
Besonders problematisch ist der fehlende lange Atem der Politik bei Investitionen in das Vermeiden von CO₂-Emissionen. Denn der Jahrhunderte währende Verbleib dieses wichtigsten Klimagases in der Atmosphäre wirkt wie eine Abschreibungsrate von nahe null: Kaum etwas vom Nutzen der Maßnahmen zur CO₂-Vermeidung (vermiedener Klimawandel, vermiedene Klimaschäden) fällt sozusagen in die Zeit bis zur nächsten Wahl. Im Ergebnis, fließt bei einem Schulden-Verbot zu wenig Geld in Klimaschutz. Das zeigt die Studie mit einem mathematisch ausformulierten „Modell einer Regierung unter Kurzfristorientierung“.
Ein „wohlfahrtsoptimales“ Ergebnis – sowohl mit Blick auf ökonomisch effizienten Klimaschutz als auch mit Blick auf Generationengerechtigkeit – ergibt sich hingegen, wenn man in dem Rechenmodell das Schulden-Verbot durch die grün-goldene Schuldenregel ersetzt. Dabei wird staatliche Kreditaufnahme für Klimaschutzmaßnahmen wieder prinzipiell erlaubt. Aber sie wird strikt gekoppelt an den Umfang der dadurch vermiedenen CO₂-Emissionen, oder alternativ an die Höhe des CO₂-Preises.
„Die wesentliche Neuerung unseres Vorschlags besteht darin, bei den Investitionen nicht die Kosten, sondern den Nutzen ins Zentrum der Betrachtung zu stellen“, erläutert Matthias Kalkuhl, Leiter der PIK-Forschungsabteilung „Klimaökonomie und Politik – MCC Berlin“ und ebenfalls einer der Autoren. Seit 1969 betrachtete der deutsche Staat die Kosten der Investitionen pauschal als Vermögenszuwachs und damit, in Anlehnung an eine „goldene Regel der Finanzpolitik“, als Rechtfertigung für neue Schulden. 2011 kam dann die Schuldenbremse – und im März 2025 der Befreiungsschlag mit Ausnahmen, unter anderem 100 Milliarden Euro für Klimaschutz. „In dieser Situation liefert unsere Studie Orientierung“, so Kalkuhl. „Und sie zeigt, dass sich die hohe Summe durchaus vertreten lässt.“
Auch die EU sollte ihre Defizitkontrolle überarbeiten
Das Forschungsteam illustriert nämlich beispielhaft die Wirkung der grün-goldenen Regel, indem sie in ihr Modell weitere Annahmen einbaut. So leitet es die Emissionsminderung aus den Zielvorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes ab. Es beziffert die Klimaschäden allein für die EU auf 200 Euro je emittierter Tonne CO₂. Und es schätzt für die Berechnung maßgebliche, in Elastizitäten ausgedrückte Reaktionsweisen, etwa wie Privatleute auf Preisänderungen bei Sprit oder Heizöl antworten. Unter den getroffenen Annahmen, die als vorsichtig bezeichnet werden, wäre für Deutschland für den Zeitraum 2020 bis 2030 eine Kreditaufnahme von insgesamt 161 Milliarden Euro für Klimaschutz vertretbar. Werden die Zielvorgaben nicht voll erfüllt, ist es automatisch weniger.
Auch für die EU-Ebene empfiehlt die Studie, die bestehende Defizitkontrolle entsprechend zu überarbeiten. Von Vorteil ist das nicht zuletzt mit Blick auf den zweiten EU-Emissionshandel für die Sektoren Gebäude und Verkehr, der 2027 starten soll und bei dem die weitere Preisentwicklung derzeit politisch umkämpft ist. Denn bei Anwendung der grün-goldenen Schuldenregel sind hohe CO₂-Preise – und damit ambitionierter Klimaschutz – für die Regierungen gleich doppelt von Vorteil. Sie bekommen, um Bepreisung im eigenen Land sozial abzufedern, nicht nur höhere Einnahmen, sondern auch mehr Spielraum für Kreditaufnahme.
- „Rechtfertigt Klimapolitik eine Erhöhung der Verschuldung? Eine grün-goldene Regel für die Klimapolitik“ – Perspektiven der Wirtschaftspolitik | [DOI: 10.1515/pwp-2025-00101]