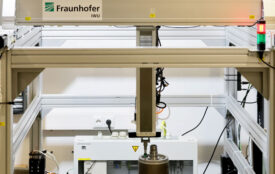Windkraft auf See droht auf Grund zu laufen
Anfang August scheiterte die Ausschreibung von 2.500 Megawatt Windkraft in der deutschen Nordsee. Die Risiken für die Projektierer seien zu hoch, sagen Offshore-Branche und Verbände. Anstelle des rein marktbasierten Ausbaus verlangen sie sogenannte Differenzverträge.
Windkraft in den Meeresweiten galt lange als Selbstläufer. Wind auf See liefert, verglichen mit dem zu Lande, an gut doppelt so vielen Stunden Strom. Meereswinde sind stabiler und so besser vorauszusagen. Und über Windparks auf dem Wasser beschweren sich höchstens Leute von der Küste aus.
Auch der Naturschutz wurde bedacht. Projektentwickler müssen einen Teil ihrer Nutzungsgelder für den Meeresschutz abgeben. Da kamen bisher mehrere hundert Millionen Euro zusammen.
Offshore-Projekte waren begehrt. Energiekonzerne wie BP, Total Energies oder EnBW zahlten noch 2023 in der Spitze bis zu zwei Millionen Euro pro Megawatt, um sich in der deutschen Nord- und Ostsee Windkraft-Standorte zu sichern.
Ende Juni dieses Jahres waren im deutschen Offshore-Bereich bereits rund 9.200 Megawatt in Betrieb. 30.000 Megawatt sind das Ziel für 2030. Da werden aber erst, so die Prognose der Beratungsfirma Deutsche Windguard, um die 20.000 Megawatt installiert sein.
Die Marke von 30.000 könnte immerhin zwei Jahre später erreicht werden, so die Windguard weiter. Denn gerade zu Anfang des kommenden Jahrzehnts sollen offshore mehrere tausend Megawatt in Betrieb gehen, die sich derzeit in den Ausschreibungen befinden.
Auch sinkende Preise retteten Ausschreibung nicht
Bei den Offshore-Ausschreibungen gibt es zwei Varianten. Die erste: Wird der Windpark auf Meeresflächen errichtet, die das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) nicht zuvor auf die Eignung für Windenergie untersucht hat, zählt allein das finanzielle Gebot der Projektierungsfirma. Gewinnt sie die ausgeschriebene Fläche, erwirbt sie auch das Recht auf ein Planfeststellungsverfahren sowie eine landseitige Netzanbindung.
Bei der jüngsten derartigen Ausschreibung hat sich Anfang Juni die North Sea OFW One GmbH durchgesetzt, eine Tochter von Total Energies. Sie verpflichtete sich, auf der Nordsee-Meeresfläche mit der Bezeichnung N-9.4 bis Anfang 2030 eintausend Megawatt Windkraft zu errichten.
Im Vergleich zu 2023 kostete es Total Energies aber nur noch ein Zehntel, die Flächenausschreibung für sich zu entscheiden, konkret 180.000 Euro pro Megawatt.
In der zweiten Ausschreibungsvariante werden die Flächen vom BSH auf ihre Tauglichkeit für Windenergie voruntersucht. Die Investoren müssen dann nicht nur ein Geldangebot abgeben, sondern auch Kriterien einhalten, etwa einen Anteil erneuerbarer Energien bei Herstellung der Windanlagen oder die Verwendung schallarmer und den Meeresboden schonender Bautechnologien oder Abnahmeverträge für den zu erzeugenden Strom.
So eine Ausschreibung für voruntersuchte Areale scheiterte Anfang August. Die Bundesnetzagentur blieb auf den beiden Nordseeflächen N-10.1 und N-10.2 sitzen. Dort sollten zusammen 2.500 Megawatt errichtet werden und 2030 und 2031 in Betrieb gehen.
Stockende Elektrifizierung, wachsende Risiken
Für Stefan Thimm ist das ein Scheitern mit Ansage. Die Branche habe seit Jahren davor gewarnt, den Unternehmen zu viele Risiken aufzubürden, so der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie Offshore (BWO). Das geltende Auktionsdesign zwinge Entwickler, nicht von ihnen beeinflussbare Risiken zu tragen – ohne jegliche Absicherung.
Steigende Risiken beim Offshore-Wind sieht auch Kerstin Andreae. Für die Chefin des Energiebranchenverbandes BDEW gehören zu den Ursachen auch gestiegene Projekt- und Kapitalkosten wegen geopolitischer Spannungen sowie Engpässe bei Lieferketten. Dazu kämen immer schwerer zu prognostizierende Preis- und Mengenrisiken im Strommarkt.
Die kommen nicht von ungefähr. Der Stromverbrauch in Deutschland stagniert, weil die energieintensive Industrie ebenso anhaltend schwächelt wie der Ausbau von Wärmepumpen, Wasserstoff-Elektrolyseuren und der E-Mobilität. Zu allem Überfluss will die schwarz-rote Bundesregierung noch tausende Megawatt Gaskraftwerke neu in den Strommarkt drücken. Die Offshore-Windkraft droht so auf Grund zu laufen.
Angesichts der risikoreichen Aussichten stören sich die Offshore-Investoren auch stärker als zuvor an den sogenannten Verschattungseffekten, von denen Windräder auf See betroffen sind. So habe das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme für die jetzt gescheiterten Flächen N-10.1 und N-10.2 errechnet, dass wegen der dichten „Packung“ der Windanlagen nur noch 2.700 bis knapp 3.000 sogenannte Vollaststunden möglich sind, lässt der BDEW wissen.
Differenzverträge sollen mehr Sicherheit bieten
Normal seien dagegen in vielen Offshore-Windparks und auf anderen weniger „verschatteten“ Flächen 3.300 bis 4.500 Volllaststunden, betont der Branchenverband.
Um die zunehmenden Risiken zu mindern, fordern Branche und Verbände vor allem, die Stromabnahme vom bisher rein marktbasierten Modell auf sogenannte Contracts for Difference (CfD) umzustellen.
Bei diesen Differenzverträgen ist der Offshore-Windstrom wie bisher zunächst am Markt unterzubringen. Bleibt der Erlös unter einer festgelegten Höhe, erhält der Betreiber vom Staat einen entsprechenden Ausgleich. Wird jedoch am Markt mehr für den Strom eingenommen als der garantierte Preis, muss der Mehrerlös zurückgegeben werden.
Ironie der Geschichte: Während die Offshore-Windenergie um die Contracts for Difference kämpft, weil das ihre Marktrisiken deutlich senken würde, tut sich die Windkraft an Land schwer mit dem CfD-Modell. Hier bekommen die Betreiber Mindererlöse bislang ausgeglichen, können Mehrerlöse aber behalten.
Der generelle Umstieg auf CfD ist in Deutschland allerdings wegen europarechtlicher Vorgaben spätestens ab 2027 nötig. Geregelt wird das voraussichtlich in der kommenden Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die für den Herbst angekündigt ist.
Naturschützer kritisieren Reform des Wind-auf-See-Gesetzes
Bereits vom Bundeskabinett beschlossen ist dagegen eine Reform des Windenergie-auf-See-Gesetzes. Da geht es aber nicht um den Strommarkt oder um die Verschattungen, sondern um Beschleunigungsflächen und schlankere Zulassungsverfahren für den Ausbau der Offshore-Windkraft. Umgesetzt werden damit auch Vorgaben der europäischen Erneuerbaren-Richtlinie „RED III“.
Diese Beschleunigungspläne werden von Umweltschützern scharf kritisiert. So warnt der Naturschutzbund, dass Nahrungs- und Fortpflanzungsgebiete von Seevögeln und Schweinswalen künftig ohne Prüfung von Umweltverträglichkeit und Artenschutz bebaut werden können. „Die Verantwortung für den Umweltschaden soll nicht beim Verursacher, sondern bei den nachfolgenden Generationen abgeladen werden“, sagte Nabu-Meeresschützer Kim Detloff.
Der aktuelle Entwurf des Wind-auf-See-Gesetzes widerspreche auch der Idee der europäischen Rahmengesetzgebung, betonte Detloff. Diese verbinde den Erneuerbaren-Ausbau mit einem wirksamen Schutz und der Wiederherstellung mariner Ökosysteme. „Dringend nötig wären streng geschützte, nutzungsfreie Meeresschutzgebiete. Aber die gibt es in Deutschland nicht“, bedauert der Nabu-Experte.
Die Bundesnetzagentur plant, die Flächen N-10.1 und N-10.2 Anfang Juni kommenden Jahres, also 2026, erneut auszuschreiben. Es bliebe also Zeit, auch die gesetzlichen Vorgaben bei den Ausschreibungen zu ändern.
Im Moment stockt der Offshore-Ausbau aber erst einmal. Das Ziel von 30.000 Megawatt rückt weiter in die Ferne.
Quelle
Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Jörg Staude) 2025 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden!