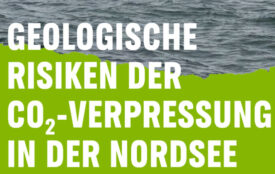Zu viel Bürokratie gefährdet klimafreundliche Flusswärme-Projekte
Knapp zwei Drittel der Haushalte ließen sich durch Wärmerückgewinnung aus Fließgewässern beheizen – doch eine Studie von Gewässerkundlern droht die vielversprechende Technologie durch überbordende Bürokratie auszubremsen. Die Scientists for Future fordern, sich mehr an erfolgreichen Umsetzungen wie etwa in der Schweiz zu orientieren.
Über die letzten Jahrzehnte hat die Menschheit Flüsse und Bäche immer weiter erwärmt – Expert:innenen schätzen eine Erhitzung um bis zu 4 Grad. Was für Lebewesen in den Fließgewässern lebensbedrohend wird, hat andererseits enormes Potential für die Wärmegewinnung. Würde man nur die Hälfte dieser Erhitzung zurückgewinnen, ließen sich damit knapp zwei Drittel der Haushalte in Deutschland beheizen, belegt eine aktuelle Studie der TU Braunschweig [1].
Derlei umzusetzen wäre vergleichsweise einfach, schnell und unkompliziert in bereits bestehenden Wasserkraftanlagen möglich. Doch in Arbeit befindliche Leitlinien von Gewässerkundlern der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, [2]) drohen die schnelle Umsetzung zu verkomplizieren.
Die perfekte Lösung?
Es klingt nach einer perfekten Lösung: Wärme zurückgewinnen, damit CO2-neutral heizen, bestehende Anlagen einfach aufrüsten und dabei auch noch Schaden abwenden, ökologische Altlasten aufräumen und den privaten Energieverbrauch beim Heizen um mehr als die Hälfte senken. Und vieles davon ist zutreffend: Fließgewässer transportieren unvorstellbare Mengen Wasser vom Land ins Meer, allein in Deutschland jedes Jahr 188 Milliarden Kubikmeter. Wer diese riesige Wassermenge auch nur um 2 °C abkühlt, kann theoretisch eine Wärmemenge von 430 Terawattstunden gewinnen. Das entspricht etwa 50 Prozent der Wärmemenge, die Deutschland für Heizung und warmes Wasser benötigt – ein enormes Potenzial auch für diekommunale Wärmeplanung. Die Forschenden der TU Braunschweig kommen dabei sogar zu dem Schluss, dass ein Wärmeentzug von 2 Grad um 60 Prozent des Wärmebedarfs für die Gebäudeheizung decken könnte. Flusswärmepumpen entnehmen Fließgewässern Wärme, um damit beispielsweise Häuser und Wohnungen zu beheizen und erleichtern durch die Abkühlung das Leben der Wasserbewohner in vom menschengemachten Klimawandel erhitzten Flüssen und Bächen.

Genug Wärme für 60 Prozent der deutschen Haushalte
Die Zunahme der mittleren Temperaturen von Fließgewässern von 3,5 bis 4 Grad Celsius in den letzten 64 Jahren war verbunden mit einer deutlichen Abnahme des Sauerstoffgehalts – ein großes Problem nicht nur für die Tierwelt. Aus Sicht von Forschenden der Scientists for Future erscheint daher eine Entzugstemperatur von 2 bis 3 Grad in der Heizperiode durchaus als ökologisch verträglich. Außerdem öffnete dies für tausende an mittleren bis großen Fließgewässern liegende Kommunen bundesweit die Möglichkeit, dieses Potenzial auch in der Wärmeplanung zu berücksichtigen, vor allem, wo Lösungen für die Zeit nach Erdgas und Heizöl wichtiger und wichtiger werden.
Eine besondere Chance bieten die 7.600 kleinen und mittleren Wasserkraftanlagen, die derzeit zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Durch eine Erweiterung auf die thermische Nutzung kann zusätzlich zur elektrischen Leistung ein Vielfaches an Wärmeleistung erbracht werden. Das ist für viele Kommunen ein willkommener Beitrag zur kommunalen Wärmeplanung. Zudem ist bereits ein Einlaufbauwerk vorhanden und ein zusätzlicher baulicher Eingriff ins Gewässer ist nicht erforderlich.
Fragwürdige Grundannahmen in LAWA-Leitlinien
Doch nun kommen Bedenken aus Naturschutzkreisen, die sich gegen eine zu starke Wärmeentnahme aus Oberflächengewässern richten: Die Gewässerkundler der LAWA sind dabei, „Leitlinien für eine ökologisch verträgliche Nutzung von Gewässern zur Wärmegewinnung“ zu beschließen, die nach Ansicht von Wissenschaftlern:innen der Scientists for Future noch eingehend überprüft werden müssen. Im Gegensatz zu anderen Institutionen wie z. B. dem bayerischen Landesamt für Umwelt verlangt die LAWA weitgehende Einzelfallprüfungen, die eine schnelle Umsetzung zur Nutzung der Flusswasserwärme eher verhindern könnten – zu viel Bürokratie auf dem Weg zu einer effektiven Wärmewende.
Vorschläge an die LAWA
Ein genauer Blick in das Papier der LAWA zeigt nach Ansicht von S4F-Expert:innen eine Reihe von Unklarheiten: So werden etwa Grenzen der Temperaturspreizung an mehreren Stellen mit starken Abweichungen genannt, unklar ist was denn nun gelten soll. Warum sind Gewässer mit einem Wasservolumenstrom von weniger als 500 Liter pro Sekunde generell von der Nutzung ausgeschlossen, obwohl genau diese Gewässer besonders stark vom Klimawandel und der daraus folgenden Gewässererwärmung betroffen sind und eine Kühlung dieser Gewässer aus ökologischer Sicht besonders wichtig ist?
Darüber hinaus transportiert eine solche Wassermenge einen Wärmestrom von 5 bis 8 Megawatt – genug, um 500 bis 800 Wohnhäuser zu heizen. Studien, die in diesen Fällen eindeutige Nachteile der Gewässernutzung durch Wärmepumpen nachweisen, sind bislang nicht bekannt.
Ebenfalls scheint eine untere Grenze der Wassertemperatur bei 3 °C, bis zu der eine Fließgewässerwärmenutzung möglich sein soll, aus gewässerkundlicher Sicht nicht ausreichend begründet. Auch mit Blick auf die an amtlichen Pegeln tatsächlich gemessenen Gewässertemperaturen erscheint dies nicht begründbar. Die untere Temperatur sollte eher bei 0 bis 2 °C gesehen werden, wie dies beispielsweise am Elbe-Pegel Blankenese mit durchgehenden Wassertemperaturen unter 2°C im Zeitraum vom 3.1.2009 bis 22.2.2009 belegt ist [3]. Die in unseren Gewässern lebende Aquafauna ist durchaus auf diese niedrigen Wassertemperaturen angepasst.
Leicht umsetzbare Leitlinien statt mehr Bürokratie
Statt mehr Bürokratie einzubringen, wäre es gerade aus ökologischen Gesichtspunkten wichtig, dass die LAWA Leitlinien erstellt, die die Nutzung von Oberflächengewässern mit Wärmepumpen schnell und unkompliziert ermöglichen. Der Verweis auf die Notwendigkeit von Einzelfallprüfungen in den Leitlinien wird aber zur Folge haben, dass aufwendige, teure und langwierige Studien mögliche Investoren abschrecken, die ökologisch grundsätzlich positive Technologie nutzen wollen. Das Bayerische Landesamt für Umwelt empfiehlt z. B. für eine Wasserabkühlung von bis zu 3 °C (nach Durchmischung) eine einfache (!) Genehmigung. Die Chance, zumindest für kleine und mittlere Anlagen einen schnellen Weg zur Genehmigung zu bahnen, würde so vertan.
Lösungsvorschläge und gesellschaftlicher Diskurs
Weiter fällt auf, dass die Leitlinie durch die für die Gewässer zuständigen Behörden aufgestellt wurde. Sie ist sicher ein richtiger erster Schritt, aber die Nichtberücksichtigung beziehungsweise Nichtanhörung der Kommunen, die sich derzeit allerorts in Wärmeplanungsprozessen befinden, wie auch der lokalen Wärmeversorger stellt ein weiteres Manko dar. Die Wärmewende ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und die Richtlinien, die sie steuern, sollten mit allen wichtigen Gruppen zusammen entwickelt werden.
Eine Lösung wäre, den LAWA-Leitfaden zunächst nur als initialen Input in einen gesamtgesellschaftlichen Konsultationsprozess zu nutzen. Parallel zum gesellschaftlichen Diskurs sollten die bisher vorhandenen Anlagen gewässerökologisch untersucht und damit eine Faktengrundlage geschaffen werden, mit der sich mögliche Grenzsetzungen besser begründen lassen. Es wäre fatal, einen so wesentlichen Baustein einer erneuerbaren kommunalen Wärmeversorgung ohne zwingende Gründe so massiv einzuschränken.
Überragendes öffentliches Interesse – Vorbild Schweiz
Das überragende öffentliche Interesse an erneuerbaren Energien bedeutet auch, dass der Ausbau dieser Energien im Gesetz als wichtig gilt für die Gesellschaft, die öffentliche Gesundheit und Sicherheit und auch gelten muss. Dies führt dazu, dass bei Entscheidungen, die den Ausbau erneuerbarer Energien betreffen, diese Interessen gegenüber anderen Belangen Vorrang erhalten.
Die Wissenschaft aus allen einschlägigen Fachbereichen ist sich einig, dass eine der Hauptbedrohungen für die Biodiversität in Oberflächengewässern die als Folge des Klimawandels steigenden Gewässertemperaturen sind. Das gilt auch für die Wintermonate, in denen die für viele Lebewesen nötige abkühlungsbedingte Durchmischung der Gewässer stark nachgelassen hat.
Der Entnahme von Wasser und dessen Rückführung in abgekühltem Zustand ist also prinzipiell ein positiver Effekt zuzuschreiben. Eine Orientierung bzgl. der Ökologie zuträglichen Wassermengen und Abkühlungseffekte könnte aus den Erfahrungen in der Schweiz gewonnen werden, wo bereits dutzende Fluss- und Seewasserwärmepumpen, zum Teil seit Jahrzehnten, in Betrieb sind.
Weiterführende Informationen und Studien
- [1] Studie TU Braunschweig: https://www.efzn.de/fileadmin/Sites/EFZN/Documents/efzn-Foerderung_2022-23/2024-12Abschlussbericht-Hydro2HEAT.pdf
- [2] LAWA: Grundlagen und Leitlinien für eine ökologisch verträgliche Nutzung von Gewässern zur Wärmegewinnung. Cottbus / Titisee-Neustadt, 2025
- [3] Institut für Hygiene und Umwelt, https://www.hamburg.de/hu/daten/
- [4] LFU BY: Wärmegewinnung aus Fließgewässern: https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_was_00364
- [5] FFE BY; Wärmepumpen an Fließgewässern: https://www.ffe.de/wp-content/uploads/2024/04/Waermepumpen-an-Fliessgewaessern.pdf
- [6] Hintergründe zu Flusswärmepumpen beim Bürgerbegehren Klimaschutz: https://buerger-
- begehren-klimaschutz.de/news/waerme-wissen-kompakt-die-flusswaermepumpe/