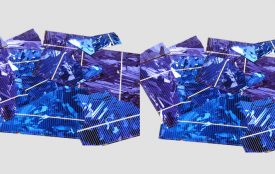Die erfolgreichen Prinzipien des EEG
Die schwarz-gelbe Regierung bremst aus dem Unbehagen vor der Demokratisierung der Energieerzeugung. Eine Begriffsbestimmung vorweg: Der Begriff „Energiewende“ tauchte schon im Jahr 1978 auf. Thomas Rotarius verwendet ihn in seinem Buch „Dauerhafte Energiequellen“, einem Standardwerk der frühen Erneuerbaren-Szene in Deutschland, das in 15 Auflagen erschien. Neu ist der Begriff also keineswegs, aber griffig, und vor allem soll das Wort Wende ihn wohl in die übrigen „Wenden“ einreihen, als da wären die 1. Wende, die Regierungsübernahme 1982, die 2. Wende, die Vereinigung der beiden Deutschlands, und jetzt eben die 3. Wende, die Energiewende. Ein Bericht von Matthias Brake
Also ganz klar eine Vereinnahmung seitens der schwarz-gelben Regierungskoalition und der Versuch, sich damit auch ein positives Image zu geben. Allerdings geschieht diese Vereinnahmung frei nach dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht. Denn die Koalition trat in erster Linie mit dem Versprechen an, die AKWs weiter laufen zu lassen und den alten Kohlekraftwerken durch eine Modernisierung noch ein langes Leben zu ermöglichen – von einer Wende zum Neuen also zunächst einmal keine Spur, eher eine Wende rückwärts. Der Feldzug gegen die Photovoltaik, als Synonym für die Erneuerbaren insgesamt, ist dabei mit solch einer Verve und offensichtlichen Lust an der Destruktion ausgefallen, wie es wohl niemand am Wahlabend befürchtet hatte.
Stromerzeugung als Bürgerrecht
Vergessen sollte man aber nicht, dass es 1990 eben auch eine konservative Koalition war, die eine Initiative von Eurosolar und einigen süddeutschen Wasserkraftbetreibern durchgewinkt hat: das Stromeinspeisungsgesetz, den Vorläufer des dann im Jahr 2000 eingeführten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Seitdem sind die Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, den aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten Strom abzunehmen und zu vergüten. Damals hatten die Erneuerbaren allerdings noch Exotenstatus und war für die Beteiligten nicht vorstellbar, wie schnell der Wandel tatsächlich stattfinden kann – wenn er nicht behindert wird.
Das Recht auf Stromeinspeisung ist nach wie vor ein Kernelement des EEG, denn nur so können sich auch Privatleute an der Energiegewinnung beteiligen und landesweit Anlagen entstehen, die erneuerbare Energie ernten, ohne dass jeder Akteur gleichzeitig zum Energieversorgungsunternehmen und Händler an den Energiebörsen werden muss. Das EEG hat aber nicht nur den Klimaschutz und die Nutzung erneuerbarer, also langfristig verfügbarer Energiequellen vorangebracht. Es wurde auch selbst weltweit zum Vorbild und bisher schon in 45 Ländern – darunter 19 der 27 EU-Staaten – in eigene Gesetze übertragen.
Was macht das EEG-Prinzip so nachahmenswert? Zunächst einmal die Erkenntnis, dass Erneuerbare Energien eine Flächenenergie sind, es gilt sie landesweit einzusammeln und auch dezentral zu nutzen. Daraus wurden die vier Grundprinzipien des EEG abgeleitet:
- das Recht auf Einspeisung ins Stromnetz auch für kleine Produzenten.
- die kostendeckende technologiespezifische Vergütung.
- Innovationsdruck durch eine regelmäßige Absenkung der Vergütungssätze (Degression) für Neuanlagen. So werden die Technologien immer effizienter und kostengünstiger.
- Kosten in der Entwicklungsphase werden nicht über Steuern, sondern transparent über den Strompreis finanziert.
Angst vor dem Wandel
Leider wurden gleich mit dem Regierungsantritt 2009 die Zeichen auf Stopp und Zurück gestellt. Der Koalitionsvertrag nennt als primäre Ziele den Bau effizienterer Kohlekraftwerke. Und die Kernenergie wurde zur „Brückentechnologie“ erklärt. AKWs und Kohlekraftwerke sind beides aber unflexible Kraftwerkstechnologien, die kaum regelfähig sind und im Zusammenspiel mit immer mehr regenerativen Strom eben nicht funktionieren.
Ohne den Fukushima-Shock und das Zurückrudern der Koalition, um einen schnellen Machtverlust zu verhindern, wäre es bei uns also zu einem Weiter-so der fossil-nuklearen Stromversorgung gekommen. Doch heute wissen wir, dass die Erneuerbaren 2012 bereits 12,6 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs (Strom, Wärme und Kraftstoffe) und 26 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms lieferten, so viel wie die Kernenergie zu ihren Peak-Zeiten, eine eindeutige Erfolgsbilanz der ersten 12 Jahre EEG.
Das geht einigen Akteuren anscheinend mächtig gegen den Strich. Der Feldzug des Gespanns Röttgen-Rösler gegen die Photovoltaik folgte so wohl dem Motto: „Du machst mir das AKW-Geschäft meiner Freunde kaputt, das zahl ich Dir bei der Photovoltaik heim.“ Mittlerweile wird nicht mehr radikal in groben Schnitten gekürzt und auch nicht mehr gedroht, dies auch noch rückwirkend zu tun. Dafür geschieht dies nun exklusiv für die Photovoltaik monatlich. Dass die Verantwortlichen mit ihren radikalen Schnitten zunächst einen enormen, weil panikartigen Zubau von 7.5 GW PV-Leistung pro Jahr auslösten, haben sie selbst wohl am wenigsten erwartet.
Quelle
TELEPOLIS | Mattias Brake 2013Der Text von Matthias Brake stammt aus dem Telepolis-eBook zur Energiewende. Im Vordergrund der Debatte um die Energiewende steht neben den Kosten und Profiten in aller Regel die Stromproduktion. Aber es geht um viel mehr – was die Situation unübersichtlich macht. Telepolis gibt mit dem eBook zur Energiewende einen längst notwendigen Überblick über die verschiedenen Bereiche von Sonne, Wind und Biomasse über Speicher, die notwendige Infrastruktur und die ungelöste Suche nach einem Endlager für den nuklearen Abfall bis hin zu Elektromobilität, Gebäudewärme und Energieeffizienz. Was ist bislang geschehen, wo mangelt es, wo wird in die falsche Richtung gegangen, welche Potenziale gibt es? Online bestellen