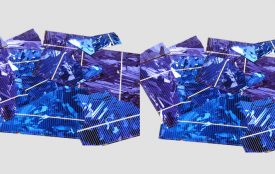Kommunale Wärmepläne: So wird das Heizen cool
Bei der Wärmewende kommt es nun auf die Kommunen an. Mit neuen Niedertemperatur-Netzen können sie das Klima schützen – und die Bürger entlasten.
Cooler heizen – das scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Doch nachdem die Ampel-Regierung sich endlich auf ein Konzept für den klimafreundlichen Umbau der Wärmeversorgung geeinigt hat, könnten in der Tat sogenannte Niedertemperatur-Wärmenetze für viele Haushalte in Deutschland die Lösung sein.
Dabei werden Häuser, in denen bisher eine Erdgas- oder Erdölheizung läuft, an ein gemeinsames neues Netz angeschlossen, das ganz oder weitgehend mit Öko-Energien betrieben wird. Der Clou dabei: Das Temperaturniveau im Netz ist relativ niedrig, trotzdem wird es in den Häusern angenehm warm.
Und: Die Hausbesitzer kommen günstiger weg, als wenn sie selbst in eine Wärmepumpe oder Pelletheizung investieren müssen.
Die Ampel-Einigung sieht vor, dass alle Städte und Gemeinden bis spätestens 2028 eine flächendeckende Wärmeplanung erarbeiten müssen. Bisher sind bundesweit nur knapp 15 Prozent der Gebäude an Wärmenetze angebunden, vor allem in den Großstädten in Straßen mit einer dichten Bebauung.
Künftig könnten es deutlich mehr werden. Denn das Konzept der Niedertemperatur-Netze eignet sich auch für kleinere Kommunen und auch für Wohngebiete, in denen die Häuser nicht so dicht stehen.
„Es funktioniert, wenn genügend Leute mitmachen“
Fachleute glauben: Stadt- und Gemeindeverwaltungen, die diesen Weg gehen, können Kurs auf Klimaneutralität nehmen, ohne Bürgerinnen und Bürger zu überfordern.
Das ist nicht mehr nur Theorie. Die Kleinstadt Steinheim an der Murr bei Stuttgart zum Beispiel zeigt, wie es geht. Der Hintergrund: Baden-Württemberg schreibt Wärmepläne bereits seit zwei Jahren vor.
In Steinheim wird ein ganzes Quartier im Nordwesten der Kommune, in dem rund 1.500 Menschen leben, auf ein solches Niedertemperaturnetz umgestellt. Hier stehen Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser, aber auch Mehrfamilienhäuser, zumeist aus den 1970er und 1980er Jahren, im Zentrum liegt ein Schulcampus.
„Eigentlich nicht das klassische Gebiet für ein Wärmenetz“, sagt der Heidelberger Energieexperte Martin Pehnt, der das Projekt analysiert hat. „Aber es ist durchgerechnet: Es funktioniert, wenn genügend Leute sich anschließen lassen.“ Und gut ein halbes Jahr, nachdem die Stadt im Oktober 2022 den Grundsatzbeschluss zum Bau des Netzes gefasst hat, scheint das gesichert.
Die Wärmenetz-Planer von der Energieagentur Kreis Ludwigsburg (LEA) gehen nach zahlreichen Beratungsgesprächen davon aus, dass auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Haushalte mitmachen wird. Etwa 40 Prozent sind mindestens nötig. Das bedeutet: Mit dem Bau des Netzes, also der Verlegung der Leitungen in den Straßen, kann Mitte kommenden Jahres begonnen werden.
Herzstück ist eine große Solarthermie-Anlage
Große Fernwärmenetze werden im Winter mit sehr hohen Temperaturen von teils 110 oder 120 Grad betrieben, kleinere Netze meist mit 80 bis 90 Grad. Auch Erdgas- und Ölheizungen in älteren Häusern laufen oft mit bis zu 80 Grad Vorlauftemperatur.
Bei Niedertemperatur-Wärmenetzen liegen die Werte deutlich darunter. Optimal ausgelegt arbeiten sie auch an den kältesten Tagen des Jahres mit weniger als 60 Grad.
„Das geringere Temperaturniveau macht den Einsatz von klimafreundlichen Wärmequellen, etwa Groß-Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen, attraktiver und kostengünstiger“, sagt Pehnt. Weiterer Vorteil: Die Niedertemperatur-Netze verlieren aus physikalischen Gründen weniger Wärme und sparen so direkt Energiekosten ein.
Quelle
Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Joachim Wille) 2023 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden!