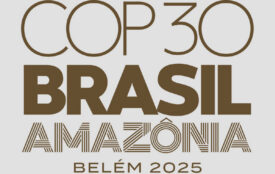Klimagipfel COP 30 endet mit Ergebnis von COP 28
Auf dem Weltklimagipfel in Belém gab es außer Klimaanpassung kaum etwas zu verhandeln. Im Zentrum standen daher andere Themen, vor allem ein Fahrplan für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Er scheiterte aber an Erdölstaaten und musste mit einem Verfahrenstrick gerettet werden.
Mit einem faktischen Nicht-Ergebnis endete am Samstagnachmittag im brasilianischen Belém die 30. UN-Klimakonferenz (COP 30). Die Staaten einigten sich im Wesentlichen auf die Entscheidung der COP 28 vor zwei Jahren. Damals fand der Klimagipfel in Dubai statt und das Ergebnis hieß daher „Konsens der Vereinigten Arabischen Emirate“ oder kurz „VAE‑Konsens“.
Dieser erwähnte zum ersten Mal überhaupt die „fossilen Energien“ und forderte alle Länder auf, sich von diesen Energien wegzubewegen, englisch „to transition away from fossil fuels“. Um das zu konkretisieren, hatte Brasiliens Präsident Lula da Silva im Vorfeld der COP 30 einen „Fahrplan“ gefordert, „um die Abhängigkeit von den fossilen Energien zu beenden“.
Mehr als 80 Staaten, darunter Deutschland und die Schweiz, stellten sich in Belém hinter diese Forderung, stießen aber auf den erbitterten Widerstand einer ähnlich großen Ländergruppe um Saudi-Arabien. Der kleinste gemeinsame Nenner, um ein Scheitern der Konferenz zu verhindern, war dann ein Verweis auf den VAE‑Konsens.
Und dann, nachdem dieses Nicht-Ergebnis im Abschlussplenum verabschiedet war, zog COP‑30-Präsident André Corrêa do Lago das Äquivalent eines weißen Hasen aus den Tiefen der UN-Verfahrensordnung: Gestützt auf seine Autorität als COP-Präsident bis zum nächsten Gipfel COP 31 lancierte er die Ausarbeitung von zwei „Roadmaps“ – einen Fahrplan zum Thema fossile Energien und einen zu Entwaldung.
Mit diesem Kunstgriff kann er zum einen sicherstellen, dass die Roadmaps Teil des COP-Prozesses sind, und zum anderen kann er dafür auf die Ressourcen des UN-Klimasekretariats in Bonn zurückgreifen. Ob diese Initiativen fortgesetzt werden, hängt allerdings von den kommenden COP-Präsidenten ab.
Anpassungs-Finanzierung wird verdreifacht – ohne Basiswert
Und auch hier gab es in Belém einen etwas eigentümlichen Kompromiss: Die Türkei und Australien einigten sich darauf, dass die COP 31 im türkischen Badeort Antalya stattfindet, aber unter australischer Präsidentschaft. COP 32 findet dann in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba unter äthiopischer Präsidentschaft statt.
Beim eigentlichen Kernthema des diesjährigen Weltklimagipfels, der Anpassung an den Klimawandel, kam es dann beinahe zu einer Revolte im Abschlussplenum. Corrêa do Lago hämmerte die Entscheidung dazu weg, ohne auf Wortmeldungen aus dem Saal zu achten.
Das kann man machen, wenn nur ein oder zwei Länder ihre Ablehnung des Beschlusses kundtun wollen, ganz nach dem Diktum von COP-Präsidentin Patricia Espinosa aus dem Jahr 2010: „Konsens bedeutet nicht, dass ein einziges Land ein Vetorecht hat.“
Doch in Belém waren die EU, die Schweiz, einige afrikanische Länder und erstaunlicherweise fast alle Nachbarländer Brasiliens dagegen, den Klimaanpassungs-Beschluss einfach durchzuwinken. Das waren dann doch zu viele Länder, um von einem Konsens auszugehen.
Das Abschlussplenum wurde deshalb für längere Zeit unterbrochen und die UN-Verfahrensordnung zu Rate gezogen. Und diese sagt: Wenn das zeremonielle Hämmerchen des COP-Präsidenten gefallen ist, dann gilt der Beschluss. Widerstand hin oder her.
Bei so viel Drama geriet dann ein weiteres Nicht-Ergebnis in den Hintergrund: Die Länder beschlossen, die Finanzmittel zur Anpassung an die Klimakrise bis 2035 zu verdreifachen – ohne sich jedoch festzulegen, was der Ausgangswert im Jahr 2025 sein soll.
Klimaschutz-Hoffnung ruht weiter auf globaler Energiewende
Kurz gesagt, die COP 30 wird nicht für ihre Ergebnisse in Erinnerung bleiben. Die Rückbesinnung auf den VAE‑Konsens hat allerdings enormes Potenzial fürs Klima. Dort haben sich die Länder auch dazu verpflichtet, die Kapazität der Erneuerbaren bis 2030 zu verdreifachen, die jährliche Steigerungsrate bei der Energieeffizienz zu verdoppeln sowie die Methanemissionen um 30 Prozent zu senken.
Eine neue Studie des Forschungskonsortiums Climate Action Tracker zeigt, dass ein Erreichen dieser Ziele einen maßgeblichen Einfluss auf die Erwärmung hätte. Ohne die drei Maßnahmen würde sich das Klima um 2,6 Grad bis zum Jahr 2100 erwärmen.
Bei einer schnellen Umsetzung der Maßnahmen bis 2030 fiele dieser Wert auf 1,7 Grad. Da trifft es sich gut, dass diese Umsetzung nicht so sehr an COP-Entscheidungen hängt, sondern am rapide fallenden Preis von Solarpaneelen, Batterien und anderen E‑Tech-Produkten.
Genau diesen Gegensatz hat auch Kaysie Brown vom Londoner Umwelt-Thinktank E3G im Blick, wenn sie sagt: „In einer zunehmend turbulenten und multipolaren Welt war die COP 30 ein Lackmustest dafür, ob der politische Wille und das Bekenntnis zum Multilateralismus mit der bereits in der Realwirtschaft erkennbaren Dynamik Schritt halten können.“
Diesen Test habe die Konferenz knapp bestanden, trotz mangelnder Entschlusskraft.
Oder anders: Das Paris-Abkommen funktioniert auch unter widrigen Umständen, und für echten Klimaschutz sorgt derzeit die Wirtschaft. Ohne das Abkommen von vor zehn Jahren wäre letztere aber vielleicht noch nicht so weit.
Quelle
Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Christian Mihatsch) 2025 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden!