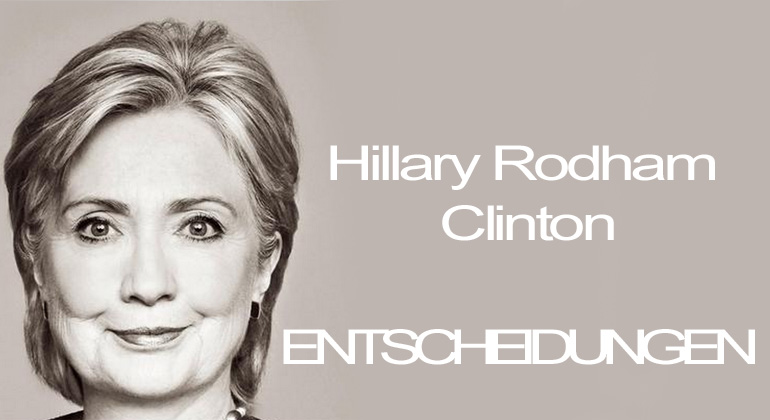Hillary Rodham Clintons Biographie jetzt erweitert
Passend zur Verkündung der Präsidentschaftskandidatur von Hillary Rodham Clinton aktualisiert der Droemer Verlag ihre Autobiographie Entscheidungen nun mit einem neuen Nachwort.
Hillary Rodham Clinton berichtet in ihrem Buch von ihrer Zeit als US-Außenministerin und von ihrem Abgang von der politischen Bühne Anfang 2013, auf die sie nun umso größer zurückkehrt, und läßt im neuen Nachwort auch ganz private Aspekte einfließen.
Hillary Rodham Clinton „Entscheidungen“
Was wir von der künftigen US-Präsidentin erwarten dürfen. Ein Buch mehr als ein Wahlprogramm. Von Rupert Neudeck – Die Buchrezension war für die Ausgabe 2014.
Das ist wahrscheinliche die dickste Wahlkampfbroschüre, die wir je in Händen gehalten haben: Mit dem Gewicht von mehr als einem Kilo liegt es in unserer Hand, 898 Seiten, und auf dem Titelumschlag blickt uns eine aufmerksame Frau direkt an, als ob auch wir Deutsche sie wählen könnten. Das Buch ist vielleicht auch die prallste und weltweit dichteste Eröffnung eines Wahlkampfes den es je gegeben hat. Denn das fast unanständig dicke Buch wurde in verschiedenen Sprachen gleichzeitig herausgebracht. In den USA heißt es „Hard Choices“, in Deutschland etwas weniger hart „Entscheidungen“.
Der Droemer Verlag, der sich ganz offenbar die Rechte an dem verkaufsträchtigen Wälzer sichern konnte, hat gleich elf Übersetzer an das Werk gesetzt, um eben am 10. Juni damit herauskommen zu können. Sie, Hillary Clinton ist ja seit einem guten Jahr (Ihr Rücktritt war am 1. Februar 2013) dabei den Wahlkampf vorzubereiten. Im ersten Kabinett Obama war sie ja noch als schärfste Demokratische Rivalin vom neuen Präsidenten eingebunden worden in dem ungeheuer wichtigen Amt der Außenministerin, im zweiten Kabinett aber wollte sie nicht vertreten sein, weil sie sich noch zu Höherem berufen fühlt und nun auch verdammt gute Aussichten hat, die nächste und erste Präsidentin der USA zu werden.
Dass die Jahre auch Spuren bei einer so erfolgreichen und spannenden Person hinterlassen haben, macht sie beiläufig im Pakistan Kapitel deutlich. Der pakistanische Präsident Ali Zardari hielt ihr eine Fotografie von 1995 vor die Augen: Auf diesem Foto seine Frau Benazir Bhutto, die kluge und großartige ehemalige Premierministerin Pakistans, mit ihren beiden kleinen Kindern an der Hand. Neben ihnen stand Clintons Tochter Chelsea als Teenager. „Und dann war da noch ich, als First Lady auf meiner ersten längeren Auslandsreise ohne Bill. Wie jung ich war! Ich hatte eine andere Frisur und eine andere Rolle“. Benazir Bhutto wurde zwei Wochen vor den Parlamentswahlen 2007 brutal ermordet. 2009 zeigte Arif Ali Zardari als der erste zivile Präsident Pakistans seit einem Jahrzehnt ihr dieses Foto.
Das ist deshalb aber nicht nur ein taktisches Buch, im Gegenteil. Es enthält einmal die klare Absage der Demokratin Hillary Clinton an den imperial-religiös-fanatischen Stil des Emperors Georges W Bush. Im Afghanistan Kapitel schreibt sie: „Konflikte enden nur selten mit einer förmlichen Kapitulation auf einem Schlachtschiff“. Das ist schon die Absage an den triumphalen Stil, mit dem G.W. Bush sich auf einem Flugzeugträger in Militäruniform feiern ließ, weil sich 2003 die US-Truppen in einem der sinnlosesten Kriege der Neuzeit in Bagdad eingenistet hatten und Saddam Hussein gestürzt hatten. Für gewöhnlich, so Hillary Clinton, entziehen anhaltende diplomatische Bemühungen, die Verbesserung der Lebensqualität und die Beharrlichkeit derer, die den Frieden wollen, den Konflikten den Boden“.
So ist das Buch voller interessanter auch für den Zeitgeschichtlicher voller Eröffnungen von bisher geheim gehaltenen Details. So dass die ersten Verhandlungen mit einem afghanischen Taliban-Vertreter in Deutschland und dann noch in München stattfanden und der damalige Afghanistan-Pakistan Beauftragte der Bundesregierung Michael Steiner sie versuchte auf den Weg zu bringen. Derjenige, der diese Versuche mit dem Gegner hart ins Gespräch zu kommen, begrüßt hatte, war Richard Holbrooke, den Hillary sehr geschätzt und von dem sie vieles gelernt hatte. Nach den Verhandlungen in München, die Holbrooke von seinem Stellvertreter Ruggiero führen ließ, kam man im Büro des State Department am 11. Dezember 2010 zusammen, um über das weitere Procedere zu sprechen. An einer solchen Stelle wiederholt die US-Diplomatin den tonus rectus aller westlichen Regierungen, die da irgendwie mit merkwürdig gutem Gewissen in Afghanistan herumhantieren.
Meist äußern sie sich in einem von der Großstadt Kabul ausgegrenzten Hochsicherheitstrakt, der sie nicht mit dem Leben von Afghanen in Berührung kommen lässt. Es liefe in Afghanistan – so schreibt sie – zwar nicht alles gut, “aber es waren erfreuliche Fortschritte zu vermelden.“ Die zusätzlichen US-Truppen würden die Offensivkraft der Taliban schwächen. Die Sicherheitslage in Kabul und in den Provinzen wie Helmand und Kandahar hatte sich verbessert, ebenso die wirtschaftliche Lage im Land. Und auch auf dem internationalen Parkett habe das diplomatische Ringen um eine Lösung für Afghanistan an Fahrt gewonnen.
Das waren alles Punkte, die nicht stimmten. Denn die sog. Taliban waren nicht geschwächt, die Kriminalität nahm zu. Von Sicherheit in Kabul zu sprechen war ein Witz. Das meinte nur, es war innerhalb des Hochsicherheitstraktes nichts mehr an Attentaten passiert. Die wirtschaftliche Situation war miserabel. Millionen junger Afghanen machten sich auf, in den wirtschaftlich blühenden Nachbarsaaten einen Job zu bekommen. Hunderttausenden gingen von Herat nach Westen, um illegal in den Iran zu gelangen.
Das Buch ist bei aller unanständigen Seitenzahl gut geschrieben, es hat in den einzelnen Kapiteln aufrechterhaltene Spannungsbögen. Es enthält auch alles, was sich jedermann unter amerikanischer Weltpolitik und Weltdiplomatie der letzten 20 Jahren vorstellt. Was auffällt: Sie ist ohne ein Komma Abstrich loyal zu ihrem damaligen Präsidenten, der es ja auch heute noch ist und den sie gern beerben möchte. Das wirkt gut, weil man nur so dieses Vertrauen weitergeben und vermitteln kann, wenn da nicht irgendein Besserwisser am Werk ist. Man fragt sich mit Vorbedacht, wo die „ „Präsidentin“ Hillary Clinton schon jetzt Entscheidungs- und Handlungsbedarf anklingen läßt. Das kommt am heftigsten zur Geltung im letzten Teil des Buches und dem Kapitel über den Klimawandel.
Da ist sie auch sprachlich auf dem Höhepunkt. Sie beschreibt die Kämpfe friedlicher Art, die 2009 auf der Klimagipfelkonferenz von Kopenhagen aus zu kämpfen waren. Es blies den USA dabei kalter Wind entgegen. Es bedurfte kreativer Strategien und hartnäckiger Diplomatie, „um ein Netzwerk weltweiter Partner aufzubauen, die willens waren, das Problem des Klimawandels gemeinsam anzupacken“. Da weiß sie, das wird weit in ihre Präsidentschaft hineingehen müssen. Deshalb sagt sie drastisch: eher ließe sich „ein Sack Flöhe hüten als ein solches Bündnis schmieden“.
Jedenfalls war für sie als Außenministerin klar: „Der Bereich Klima und Energiepolitik war Teil einer umfassenden Reform, der wir unsere gesamte Außenpolitik unterziehen wollten“. China und Indien sind da gemeinsam nicht einfach Partner, sondern Gegner. China hatte mehrere Hundert Millionen Menschen aus einer entsetzlichen Armut geholt, als 1978 Deng Xiaoping die Öffnung einleitete. Und diese Frage stellt sich für die hinterherhetzenden großen Länder ja weiterhin. Kann es sich China leisten, den Klimawandel zu bekämpfen, wenn etliche Millionen Menschen noch immer in Armut leben? „Würde es einen Entwicklungsweg einschlagen können, der auf erneuerbarer Energie beruhte und dennoch die Armut weiter eindämmen half“? Indien warf ihr 2009 den Fehdehandschuh hin.
Der Umweltminister Jairam Ramesh sagt es in Delhi ganz hart. „Maßnahmen gegen den Klimawandel sollten die Aufgabe der Vereinigten Staaten sein, nicht die von Schwellenländern wie Indien“. Die Autorin verweist auf die nächste große Gipfelkonferenz, in der im Dezember 2015 ein ganz neuer Ansatz versucht werden wird: Und der wird, um überzeugend und erfolgreich zu sein, auf dem kleinsten erreichbaren Nenner vorbereitet werden, mit dem man das Ziel, die Erwärmung bei zwei Grad zu belassen, nicht erreichen wird.
Die Autorin und wohl künftige Präsidentin beschreibt die Anstrengungen, die die Weltgemeinschaft unternommen hat, den Umsturz in Libyen und in Syrien in von der UNO mitgelenkte Bahnen zu leiten. In Syrien hatte man sich entschlossen, nicht das zu tun, zu dem US-Regierungen in den letzten zwei Generationen immer bereit waren: Truppen und Militärs zu schicken. Obama ist verdammt vorsichtig bei dem Vorangehen auf internationalem Parkett. Er definierte schon die rote Linie, als Rußland bereit war, Baschar al Assad zum Einlenken mit seinem Chemiewaffenarsenal zu veranlassen. Sätze kommen immer wieder vor, die angeben: Sie lässt sich nicht unterkriegen. „Meine Frustration wuchs, doch ich ließ mich nicht beirren!“ Für Syrien hält sie ein deutsches Wort bereit, das es im englischen ähnlich gibt: Es sei ein „vertracktes Problem“.
Für vertrackte Probleme gebe es nur in seltenen Fällen „richtige Antworten“: sie sind u.a. deshalb vertrackt, weil jede Option schlechter erscheint als die nächste. So hätte es in Syrien ausgesehen: „Tut man nichts versinkt man in einer humanitären Katastrophe“, greife man militärisch ein, laufe man Gefahr, die Büchse der Pandora zu öffnen und wie im Irak in einen Morast zu geraten. Versorge man die Aufständischen mit Hilfsgütern, müsse man sehen, wie sie am Ende den Extremisten in die Hände fallen. Setze man die diplomatischen Bemühungen fort, steuere man geradewegs auf ein russisches Veto zu. Alles eben „vertrackt“.
Das Syrien-Kapitel ist wirklich luzid, denn sie beschreibt den Sonnenkönig in Damaskus als letzten Monarchen, der auch noch keinen tragfähigen Nachfolger geschweige eine Alternative hat. „Wie Ludwig XV., so konnten auch Assad wie seine Verbündeten ‚Apres moi le deluge‘ sagen“: Nach mir die Sintflut. Und sie sagen es ja auch andauernd selbst oder über ihre journalistischen Verbündeten im Westen. Am 9. September 2013 war Obama fest entschlossen, mit Luftschlägen auf Damaskus Assad zum Einlenken zu zwingen, da sagte Außenminister Kerry die Sätze, die von Moskau aufgegriffen wurden und zum Ende des Chemiewaffenarsenals geführt haben: Assad könne seine „sämtlichen Chemiewaffen der internationalen Gemeinschaft übergeben und zwar jetzt ohne jede Verzögerung“. Die OPCW wurde aktiviert die UN-Behörde zur Überwachung des Chemiewaffenabkommens und zumindest das konnten geschehen, aber am Leiden der Bevölkerung, der wie üblich unschuldigen Frauen und Kinder änderte sich nichts. Am Ende sagt Hillary Clinton: „Auch als Privatperson kann man das Leiden in Syrien unmöglich beobachten, ohne sich zu fragen, was man hätte tun können“. Auch bei vertrackten Problemen.
Das Buch geht noch in die Wikileaks Affaire und den Versuch des US-NSA-Agenten ein, die Überwachung der gesamten digitalen Kommunikation zu organisieren. Im November 2010 wurden über 250.000 gestohlene Dokumente des State Department veröffentlicht, meist vertrauliche Lageberichte. Der Obergefreite Bradley Manning hatte die Geheimdokumente von einem Computer des Verteidigungsministeriums heruntergeladen und dem Wiki Leaks Gründer Julian Assange zu- gespielt. Die Autorin ist aber nicht nur bierernst bei der Ablehnung dieser Methode, denn sie kann zu Recht sagen, dass es Diplomatie nur mit Mitteln vertraulicher Depeschen geben kann. Aber manche aufgedeckten Dokumente enthalten unterhaltsame Tatbestände. So erwähnt sie eine Depesche über Robert Mugabe, den Alleinherrscher von Simbabwe, der in seiner totalen wirtschaftspolitischen Ignoranz der Meinung war, seine 18 Doktortitel würden ihn befähigen, die Gesetze der Volkswirtschaftslehre außer Kraft zu setzen. Wikileaks sei aber nur der Vorgeschmack des Geheimnisverrats gewesen, den Edward Snowden geleistet hatte. Er „stahl eine große Menge höchst vertraulicher Dateien und gab sie an Journalisten weiter“.
Sie ist aber klug genug, eine Änderung der Politik anzukündigen. Sie ist uneingeschränkt dafür, dass „dieselben Rechte, die uns im ‚echten Leben‘ wichtig waren, auch online galten“: uns zu versammeln, frei zu äußern, zu forschen, uns zu engagieren. Zu dem Problemfeld Freiheit und Sicherheit ist sie nicht klar. Zitiert dafür den allerdings klaren Benjamin Franklin: „Wer eine wesentliche Freiheit aufgibt, um eine geringfügige bloß zeitweilige Sicherheit zu bewirken, verdient weder Freiheit noch Sicherheit“. Dem widerspricht sie: Ohne Sicherheit ist Freiheit brüchig. Ohne Freiheit bedeutet Sicherheit Unterdrückung. Und wir alle lassen uns gefallen, dass wir berieselt werden von „Sicherheitshinweisen“ auf Flugplätzen und Bahnhöfen, in denen wir angemahnt werden, wir sollten unser Gepäck und unsere Nachbarn „nicht unbeobachtet lassen“.
Ein Buch, das man gut lesen kann, was man nicht von allen Erinnerungen von Großpolitikern sagen kann. Das liegt aber auch daran, dass das nur eine Programmbotschaft ist mit Erinnerungen an die Jahre, in denen sie bewiesen hat, was sie kann. Alexis de Tocqueville hatte der großzügigen Nation der USA zugeschrieben, dass „die Gewohnheiten des Herzens“ die Stütze der Demokratie seien und die Siedlerfamilien dazu brächten, ihre Scheunen hochzuziehen und Quilts zu nähen. Hillarys Mutter sei es gewesen wie viele tausend andere, die nach 1945 Care Pakete mit Milchpulver, Schokolade und Dosenfleisch an hungernde Familien in Europa und Deutschland geschickt haben. Das sei weiter ein Pfund, mit dem die USA wuchern könnten, in der humanitären wie der Entwicklungspolitik, über die sie auch noch ein Schlusskapitel schreibt als Fallbeispiel der Hilfe für das erdbebenerschütterte Nachbarland Haiti.
Hillary Rodham Clinton „Entscheidungen“