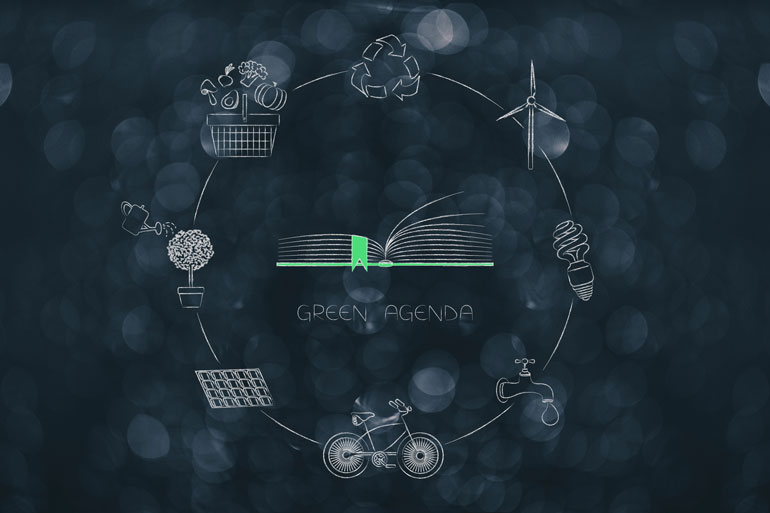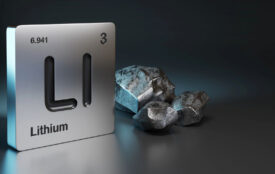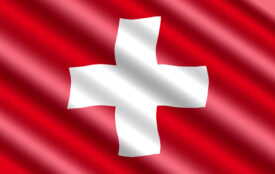„Neustart“ der Energiewende: Energiepolitik mit und ohne Klimaziel
Die Vorgaben für das von Wirtschaftsministerin Reiche bestellte Energie-Monitoring sind mangelhaft, ergibt eine Analyse. Untersucht würden auch Szenarien, die das verfassungsrechtlich untermauerte Klimaziel gar nicht einhalten.
Die Energiewende im Stromsektor hat vor 25 Jahren Fahrt aufgenommen. Nach dem Start unter der rot-grünen Bundesregierung mit EEG plus Atomausstieg erfolgte in der Ära Merkel ein Abbremsen des Umbaus („Altmaier-Knick“) und dann ein neuer Push durch die Ampel-Regierung.
Nun plant das Kabinett von Kanzler Merz einen „Neustart“ der Energiewende, und kritische Fachleute befürchten, dass dies einen „Reiche-Knick“ bedeuten könnte. Schließlich hat die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) über die Ampel geurteilt, sie habe ein „völlig unrealistisches und überzogenes Erneuerbaren-Ziel“ verfolgt, das korrigiert werden müsse.
Die schwarz-rote Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag ein Monitoring ankündigt, das die Grundlage für ihre energiepolitische Agenda bilden soll. Im Raum steht ein weniger ambitionierter Erneuerbaren-Ausbau – aufgrund eines weniger schnell steigenden Strombedarfs und fehlenden Netzausbaus.
Die Sorge geht nun um, mit dem neuen Kurs könnten die für 2045 beschlossene Klimaneutralität verpasst und den Energiewende-Unternehmen Chancen genommen werden.
Genau das untermauert eine Untersuchung im Auftrag der NGO Germanwatch, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Darin werden die Ziele des Monitorings analysiert, mit dem das Energiewirtschaftliche Institut der Universität Köln (EWI) beauftragt wurde.
Hauptkritik: Vorgabe für das Monitoring sei gewesen, Potenziale zur Kosteneinsparung durch ein Bremsen des Erneuerbaren-Ausbaus und mehr fossile Energienutzung zu finden – statt Herausforderungen wie die Modernisierung und den Ausbau der Strom-Verteilnetze in den Blick zu nehmen, um die Energiewende kosteneffizient zu beschleunigen.
„Ministerium will nur beobachten statt gestalten“
Die Studie zeigt nun, dass nicht alle dem Monitoring zugrunde gelegten Szenarien das Ziel der Klimaneutralität erreichen. Germanwatch-Vorstand Christoph Bals hält das für unzulässig: „Der Koalitionsvertrag bekräftigt klar das Ziel der Klimaneutralität bis 2045, welches aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils 2021 beschlossen und zudem jüngst im Grundgesetz verankert wurde.“
Szenarien, die damit nicht im Einklang stehen, dürften nicht als Grundlage für Empfehlungen des Monitoringberichts und damit für politische Entscheidungen genutzt werden, sagte Bals.
Kritik an den Vorgaben für das Monitoring hatte bereits die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geäußert. Sie warf dem Reiche-Ministerium vor, es habe mit der Leistungsbeschreibung bereits eine gezielt niedrige Prognose für den Stromverbrauch bis 2030 vorgegeben.
Wichtige Innovationsfelder wie Elektromobilität, Wärmepumpen, KI-Rechenzentren und Energiespeicher sollten laut DUH gar nicht berücksichtigt werden. Dies führe zu einer Unterschätzung des tatsächlichen Ausbaubedarfs bei den Erneuerbaren und den Netzen.
Der Autor der Germanwatch-Studie, der Energiesystemexperte Tim Meyer, kritisiert, wie das Monitoring generell angelegt ist. „Die Ausschreibung erweckt den Eindruck, als wolle das Wirtschaftsministerium sich in eine Beobachterrolle eines ‚Weiter so‘ zurückziehen, anstatt die sektorenübergreifende Gestaltungsaufgabe Energiewende entschlossen anzunehmen“, sagte Meyer.
Nicht überprüfbare Annahmen
Damit drohe das Monitoring etwa zu unterschätzen, wie stark die Stromspeicher-Kapazitäten wachsen könnten, was Folgen für die Gesamtkonzeption des künftigen Elektrizitätssystems hat. Zugleich könne damit der tatsächliche Handlungsbedarf verpasst werden, „ebenso wie die industriepolitischen Chancen einer vorwärtsgewandten Modernisierungsagenda“.
Die Germanwatch-Studie bemängelt weiter, einige der im Monitoring hinzugezogenen Szenarien von Marktakteuren setzten stark auf die Nutzung von „blauem Wasserstoff“, der aus Erdgas hergestellt wird, oder auf die Speicherung von CO2 im Untergrund, sprich auf CCS.
Problematisch sei hier, dass weder die Mengengerüste noch die Kostenannahmen zu diesen Technologien offengelegt würden. Auch das Problem, dass die dabei unvermeidlich entstehenden Restemissionen an anderer Stelle kompensiert werden müssten, werde nicht angemessen behandelt.
Bals von Germanwatch betonte: „Wir haben die Chance, durch die entschlossene Modernisierung unserer Energieinfrastruktur, den Ausbau der Erneuerbaren und die Nutzung von grünem Wasserstoff im Stromsektor schnell Emissionen zu senken und perspektivisch klimaneutral zu werden.“
Der Stromsektor leiste auch einen ständig steigenden Beitrag zur schnellen Dekarbonisierung der anderen Sektoren. Hier gelte es nun aber, die Ursachen aktueller Verzögerungen und Engpässe politisch zu bearbeiten, „anstatt die Dekarbonisierung des Stromsektors zugunsten fossiler Lösungen zu verschleppen“.
Bals erinnerte an die Vorgabe des Verfassungsgerichts. Dieses habe in seinem Urteil von 2021 sehr deutlich gemacht, dass eine Verringerung der Klimaschutz-Ambitionen nicht zulässig sei. Dadurch werde nämlich der Freiheitsraum der jungen Generation über Gebühr eingeschränkt, „weil diese später unter noch mehr Druck handeln und in noch größeren Mengen Negativemissionen erzielen muss“.
Quelle
Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Joachim Wille) 2025 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden!