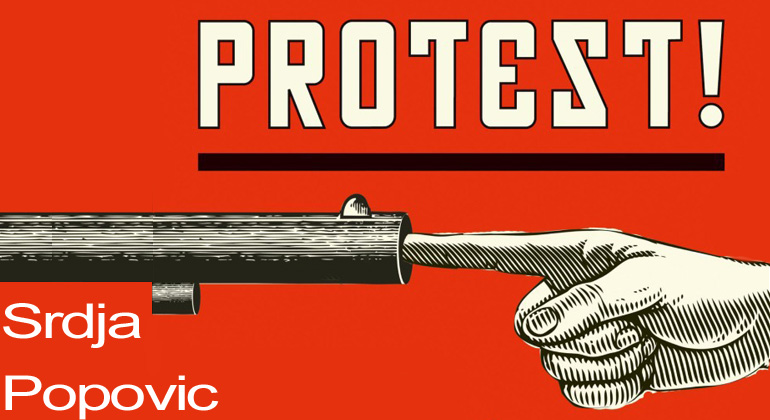Protest – Wie man die Mächtigen das Fürchten lehrt
Wie man ohne Waffen umstürzen kann! Und dass man keine „fremden Arschlöcher mit Koffern“ braucht. Zu einem Buch über die NGO Otpor und Kindern der Organisation in anderen Ländern. Von Rupert Neudeck
Es könnte in naher Zukunft mal so werden, dass dieses Buch eine ähnliche Bedeutung für den zivilen Umsturz abgeben könnte wie seinerzeit das Guerilla Handbuch des vietnamesischen Generals Vo Nguyen Giap, der vor kurzer Zeit gestorben ist. Das Buch ist sehr gut und zu seinem Anlaß kongenial geschrieben. Der Autor wirkt von seinem Erfolg bei der Urrevolution, dem Sturz Slobodan Milosevic, beflügelt. Ist aber auch spritzig und witzig und macht mit allem, was er aus seiner Erfahrung und Umtriebigkeit berichtet Mut. Ganz am Ende möchte er den selbstbestimmten Leser noch bitten, die vielen Verschwörungslegenden nicht mitzumachen, die es zu der Bewegung von OTPOR gibt. Sie werden Menschen begegnen – schreibt er in einer Art Nachwort – die nicht glauben, dass ein Mensch allein etwas bewegen kann. Sie wittern hinter allem Verschwörungen, natürlich – je nach Geschmack – unterwandert entweder von dem CIA, dem NSA, der Weltbank oder dem KBGB. Wörtlich: „Diese Typen haben mich und meine Kollegen als Marionetten der Vereinigten Staaten, als blinde Werkzeuge von George Soros und der Bilderberg Group, als serbische Agenten oder Schlimmeres beschimpft“. Das wirkt glaubwürdig in der scharfen und kurzen Diktion, denn das Buch, das alle diese Erfahrungen vor uns aufblättert, wirkt sehr überzeugend. OTPOR war die Ausgangsbewegung, die Europa und uns Europäer von dem Alptraum eines mächtigen aber auch sich selbst maßlos überschätzenden Diktators in Serbien befreite. Dann gründeten die OTPOR Mitglieder CANVAS, Centre for Applied Nonviolent Actions and Strategies“.
Es ist ein Handbuch für zivile Revolutionen geworden, die Grundsätze wirken absolut überzeugend. Wenn man etwas Großes erreichen will, muss man die Menschen, die Mehrheit der Menschen erreichen, nicht eine Elite in einem Elfenbeinturm. Man muss die Mehrheit bei alltäglichen Bedürfnissen abholen. Man muss versuchen, Diktaturen und Diktatoren so lächerlich zu machen, dass man bei der Lektüre selbst ins Lachen kommt. Man muss Planung beherzigen und Disziplin; eine Bewegung, die nicht zur Einigkeit in der Lage ist, wird es nicht schaffen, den Diktatur und die Diktatur zu beseitigen. Das Beispiel Syrien in den letzten vier Jahren ist das sprechende Beispiel dafür geworden.
Das Buch enthüllt vieles, aber nicht alles, was man zu OTPOR wissen möchte. Aber es ist die spannende Erzählung von jemandem, der mit seinen Mit-Revolutionären in Serbien es damals geschafft hat, Milosevic zu stürzen. OTPOR wurde dann eine Marke, die andere junge Revoluzzer herausforderte, die auch gern mal einen Besuch bei den siegreichende Gevattern der Revolution machten, die es in Belgrad geschafft hatten. Das Buch gibt Auskunft über die Begegnungen mit Israelischen Friedensaktivisten, mit solchen in Syrien, in Ägypten, im Sudan, in Georgien und – überraschenderweise auch auf den Malediven, dem Ferienparadies. Das Buch und sein Autor gehen davon aus, dass die Situationen sich in den verschiedenen Revolte-Ländern kulturell, religiös und politisch meist nicht vergleichen lassen. Als die ägyptischen Gäste der Demokratiebewegung nach Serbien kamen, war es zunächst darum gegangen, dass es bei ihnen anders gehen müsse. „Ich würde keine arabische Frau dazu bringen, die erfolgreichen Demonstrationen der Femen-Demonstrantinnen in der Ukraine nachzuahmen und in Riad ihre Brüste für Gleichberechtigung zu entblößen“. Die religiösen Ägypter grinsen. Aber man muss den einschneidenden Klick finden, der die ganze Gesellschaft in Bewegung bringt.
Man muss erst genau analysieren, die Kräfte und Stärkeverhältnisse und dann herausfinden, was man machen kann. Gandhi wusste, dass die Inder der britischen bestausgerüsteten Armee immer unterlegen gewesen wären. In einer offenen Feldschlacht wären die Inder hoffnungslos unterlegen gewesen. Gandhi benötigte ein Thema, Unabhängigkeit und Selbstbestimmungsrecht hingen schon in der Luft. Aber 1930 fand Gandhi die Antwort: Salz. Meist, so der Autor, sind die besten Themen, die dann zum Umsturz führen, solche, die mit dem Essen zu tun haben. Salz fand Gandhi. „Jeder Mensch braucht Salz.“ Eigentlich sollte das Salz gar nichts kosten, denn Indien hat eine 7525 km lange Küste. Früher mussten die Inder nur ans Meer gehen, einen Topf mit Wasser füllen, es verdampfen lassen und schonhatten sie ihr Salz. Die britische Kolonialverwaltung verlangte Salzsteuern. Statt also einen bewaffneten Widerstand zu beginnen, versammelte Gandhi genial seine 77 Anhänger, verkündete, er werde durch die Lande bis an die Küste marschieren, dort Salz aus Meerwasser gewinnen und sehen, ob die Briten ihn daran hindern würden. Als Gandhi am Meer war, hatten sich ihm 12.000 Inder angeschlossen. Die meisten waren gekommen, weil sie Salz wollten. Da Salz so grundlegend und das Thema so einleuchtend war, gewann Gandhi mit dem Salzprotest Anhänger aller Glaubensrichtungen und Kasten. Die Kolonialmacht knickte ein, Gandhi hatte gewonnen.
Popovic: Das sei einer der Gründe, weshalb sich Aktivisten gern für bessere und gesündere Lebensmittel einsetzten. „Jeder hat eine Beziehung zum Essen. Jeder ist betroffen. Essen ist immer eine gute Möglichkeit, Menschen zu mobilisieren“. So wie die Briten Amerika durch den Tee verloren, so mussten sie Indien durch das Salz verlieren. Popovic zitiert oft eines seiner Vorbilder, das ist Harvey Milk. Er war der erste bekennende homosexuelle Politiker der Vereinigten Staaten. Milk kandidierte in San Francisco für die Wahl und bekannte sich dabei zu seiner Homosexualität. Natürlich verlor er. Daraus lernte er, er machte den Hundekot zu seiner Sieg-Strategie. Milk hörte seinen Mitbürgern in San Francisco gut zu. Sie sorgten sich weniger um ihre Seelen als um ihre Sohlen. Fast alle beschrieben die stinkenden Hundehaufen in den Parks als übelste Plage. Das war der Volksfeind Nr. eins. Nach langen Jahren der Auseinandersetzung hatte Harvey Milk gelernt, die Auseinandersetzungen auszutragen, die er gewinnen konnte. Mit dem Hundekot aufzuräumen war einfach. Der Kampf um die Rechte der Homosexuellen in einer gleichgültigen heterosexuell bestimmten Stadt war schwierig und brauchte einen langen Atem.
Im Kapitel Zukunftsvisionen schildert er den Kampf in den touristischen Ferieninseln der Malediven gegen den seit drei Jahrzehnten amtierenden brutalen Diktator Maumoon Abdul Gayoom. Da dieser von den Tourismus abhängig war, sorgte er dafür, dass kein Tourist etwas von der Unterdrückung mitbekam. Er sorgte dafür, dass in dem streng islamischen Inselreich für die Touristen Alkohol ausgeschenkt werden darf. Während es den Touristen in den Luxus Hotels glänzend ging, ging es dem Rest der Bevölkerung schlecht. Gayoom war Freund von Saddam Hussein und hatte jeden Widerstand verboten. Dann kam es am zweiten Weihnachtstag, am 26.12 2004 zu dem Tsunami, der ganz Südostasien bedrohte. Als die Wellen danach zurückwichen, gab es nichts als ein Meer von zerbrochenen Brettern, Möbeln, zerfetzten Palmdächern, zwischen denen sich verletzte Menschen regten. Es gab Widerstand von drei Gruppen, einmal den gebildeten Dissidenten, die von Pressefreiheit schwafelten, ein Thema, das einen Fischer in einem fernen Atoll kaum vom Hocker reißt. Dann gab es die Islamisten, die auf den Malediven das islamische Recht einführen wollten und dann gab es die Drogenabhängigen, die auch in die Gefängnisse geworden wurden. Die Behörden gaben angeblich Heroin an die Häftlinge aus. Das Thema, mit dem der Diktator gestürzt wurde: Reispudding. Für die Malediver ist Reispudding eine Nationale Kultspeise. Als es daher das Gerücht gab, es würde am Strand eine Reispuddingparty veranstaltet, kamen Hunderte Neugierige. Der Spaß mit dem kostenlosen Reispudding endete, als die Polizei kam, um den Pudding zu konfiszieren. Als die Bürger sahen, dass die Handlanger Gayooms den Pudding in ihre Autos verluden, war das Thema für die Dissidenten klar. „Doch die Revolution lebt nicht vom Reispudding allein“, schreibt der Autor, der eine umwerfend eindringlich-klare Sprache hat. Der Groschen fiel erst im Kino. Die Reispuddingparties wurden überall an den Stränden verteilt organisiert, aber es wurde plötzlich der Dokumentarfilm gezeigt, den Steve York 2002 von der OTPOR-Kampagne gedreht hatte: „Bringing down a Dictator“.
Zu der Wirkung von Lachen oder dem Wort, das Popovic hier erfindet: Lachtivismus, gibt es die schöne Beschreibung, wie die Mitglieder von OTPOR sich klar wurden, dass es eigentlich gar nicht gehen kann gegen diesen Milosevic. Sie haben keine Armee, sie haben kein Geld, sie haben keinen Zugang zu den mächtigen Medien, der Diktator hatte eine nationalistisch verblödende aber wirksame Vision. Und er hatte ein Instrument, das durchzusetzen: die Angst. Damals erfanden sie das „Grinsefass“. Man könnte die Angst nur durch Lachen besiegen, gleichsam weglachen. Das hatte Popovic schon bei Monty Python gelernt, ein Lehrmeister für ihn wie der Roman „Der Herr der Ringe“. Sie wollten die Menschen zum Lachen bringen. Sie organisierten ein altes Blechfass und baten den Designer der Gruppe, ein möglichst realistisches Bild des Diktators auf das Fass zu pinseln. Zwei Tage grinste ein fieser Milosevic von dem Fass entgegen. Das Gesicht war so komisch, dass selbst ein Zweijähriger gelacht hätte. Dann schrieben sie noch dazu: „Schlag ihm die Fresse ein. Nur ein Dinar!“ Sie brachten das Fass in die Knez Mihailovska Strasse, eine verkehrsberuhigte Strasse im Zentrum Belgrads. Die Gruppe stellte das Fass mitten auf die Strasse und zog sich in ein benachbartes Cafe zurück. Es entwickelte sich eine Mischung aus Gruppenzwang und Herdentrieb. Passanten schauten zu, dann deuteten sie dorthin und fingen an zu lachen. Die Passanten hatten ihren Spaß, der Lärm war durch das auf das Fass schlagen bis zum Kalemogdan Park zu hören. Dann rückte die Polizei an. In dem Moment erfand Popovic sein „Polizeispiel“.
Er spielte es hier zum ersten Mal. Die Polizei wollte die Organisatoren des Protests verhaften, sah aber niemanden. Sie konnte die Leute verhaften, die vor dem Fass Schlange standen, oder sie konnten das Fass selbst festnehmen. Die Leute hätten sich das nicht gefallen lassen, wenn sie einfach auf der Straße festgenommen wären. Also nahmen die Polizisten das Fass in Beschlag. Sie drängten die Passanten zur Seite, nahmen das Fass in die Mitte und schleppten es zum Streifenwagen. Dann sorgte die OTPOR Gruppe dafür, dass das fotografiert wurde und die Bilder am nächsten Tag verbreitet wurden. Das war buchstäblich unbezahlbare Werbung. Dieses Bild sagte mehr als 1000 Worte. Wer es sah, wußte, dass Milosevic‘ gefürchtete Polizei nicht mehr war als ein „komischer Haufen unfähiger Trottel“.
Die Zivil-Revolutionäre fallen auf durch unglaublich intelligenten Humor. So auch die Organisatoren der ägyptischen Revolte gegen Hosni Mubarak. Mohammed Adel und seine ägyptischen Freunde, die von der Otpor profiziert hatten, waren Meister des Lachtivismus. Ein Bild wurde gezeigt, das einen Window-Installationsbildschirm zeigte, von einem Server namens Tunesien sollte eine Datei namens „Freiheit“ installiert werden. Doch dann tauchte eine herrliche Fehlermeldung auf: „Freiheit kann nicht installiert werden, entfernen Sie Mubarak und versuchen Sie es noch einmal!“ Mohammed Adel und seinen Mitstreitern war es zu verdanken, dass „es cool wurde, jeden Tag auf den Tahrir Platz zu kommen und sich als politisch aktiv zu zeigen“. Jeden Tag strömten mehr Demonstranten auf den Platz, nicht nur, um Mubarak zu stürzen, sondern auch um Teil dieser coolen Aktion zu werden.
Popovic fasst das alles am Ende zusammen: „Gewaltlose Aktionen von heute verschieben die Taktiken weg von Ressentiments, Ärger und Wut hin zu einem viel wirkungsvollerem Aktivismus, der mit Spaß bereitet“. Und dieser Aktivismus sei umso wirkungsvoller, je härter Diktaturen dagegen vorgehen. Das nächste Kapitel nennt Popovic: Wenn Unterdrückung zum Bumerang wird. Das ist ein Gesetz geradezu. In Serbien hatten sie gelernt, dass es gegen die Angst vor dem Unbekannten ein Mittel gibt: das Wissen. Sie lernten alle das Gefängnis kennen, wussten dann also was es bedeutet, verhaftet zu sein. Aber das Buch enthält auch sehr viel Kritik an denen, die meinen, sie könnten nach dem Sturz des Regimes nur noch feiern. Die Aufgaben, Korruption und Misswirtschaft zu bekämpfen bleiben weiter. Er beschreibt es am Beispiel der Ukraine, wo die große Bewegung PORA (dt. etwa Es ist Zeit) einen so grandiosen Sieg mit der orangenen Revolution errang. Sie setzten den fast ermordeten (mit Dioxin vergifteten) Juschtschenko als Präsidenten durch. Popovic „Es war eine großartige Geschichte, und er würde gern berichten, „dass die Ukraine heute ein Leuchtfeuer der Demokratie und der Menschenrechte in der Region ist“.
Aber genau das kann er nicht. Die „Pora“ Aktivisten hatten nicht den langen Atem, ihre Fähigkeiten die Ukrainer zu einen, auch nach dem Wahlsieg von Juschtschenko weiter einzustehen. Sie gingen einfach nach Hause. Juschtschenko hatte eine ehrgeizige Premierministerin, mit der er im Dauerclinch stand. Janukowitsch griff als Mini-Putin ein weiteres Mal nach der Macht und siegte. „Doch die Macht des Volkes ist wie ein Flaschengeist“, wenn sie einmal aus der Flasche entkommen ist, lässt sie sich nicht wieder einfangen. Die Ukrainer waren wieder dabei auf dem Maidan zu protestieren und sie jagten Janukowitsch aus dem Land. Die Ersten, die mit den EU-Fahnen ihr Leben ließen, waren Ukrainer.
Er bleibt kritisch. Man kann nie von außen ein Land ändern, reformieren, revolutionieren. Dann bleiben selbst OTPOR Aktivisten „fremde Arschlöcher mit Koffern“. Überall muss die Bewegung aus dem Lande kommen. Und sie sollte sich an Gandhi ein Beispiel nehmen. Der erste Salzmarsch und der Kampf bis zur Unabhängigkeit dauerte 17 Jahre.
Srdja Popovic „Protest – Wie man die Mächtigen das Fürchten lehrt“ | online bestellen!